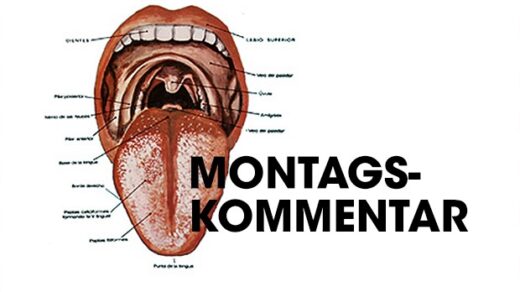Wo über Doktorarbeiten geredet wird, ist eine Plagiatsdebatte nicht weit. Dabei haben Promovierende ganz andere Probleme. Von Valerie Schönian

Illustration: Robin Kowalewsky
Hans Brittnacher braucht keine schlaue Software, um Plagiate zu finden. Wenn eine Hausarbeit auf den ersten Seiten vor Grammatikfehlern strotzt und dann drei Seiten makelloser Prosa folgen; wenn eine Ortsangabe in der Fußnote blau und unterstrichen ist; oder wenn zwei Studierende eine komplett identische Hausarbeit abgeben – dann erkennt er die Kopie auch mit bloßem Auge.
Brittnacher ist Professor für Neuere Deutsche Philologie an der Freien Universität. Er hat schon einige Betrugsversuche gesehen – in Master- und Bachelorarbeiten. In einer Doktorarbeit aber noch nie. Während ganz Deutschland immer wieder medienwirksam über neue Plagiatsskandale bei Promotionen diskutiert, weiß Brittnacher: Die wichtigen Probleme des wissenschaftlichen Arbeitens von Doktoranden sind nicht die Plagiate – sie liegen ganz woanders. Etwa bei der Betreuung: Für 21 Doktoranden ist Brittnacher zurzeit verantwortlich. Zu viele? „Es ist zumindest grenzwertig“, sagt er. „Aber wenn ich es nicht mache, macht es keiner.“
Denn nicht jeder Professor ist bereit, Doktorarbeiten zu übernehmen. Der Grund: Für das Betreuen eines Doktoranden gibt es kein Geld. Wer promoviert, steht am Ende der universitären Nahrungskette. Unter dem Geldmangel leidet aber nicht nur die Betreuung, sondern auch das Portemonnaie der Promovierenden. Wissenschaftliche Mitarbeiter an Lehrstühlen haben meist nur eine halbe Stelle, laut Vertrag knapp zwanzig Stunden pro Woche. De facto arbeiten drei Viertel von ihnen 40 Stunden und mehr. Dafür bekommen sie brutto je nach Dauer der Beschäftigung 1100 bis 1300 Euro.
Christof Mauersberger und Frithjof Stöppler sind nach ihrem Master dennoch im Unibetrieb geblieben. Mauersberger promoviert in Internationaler Politischer Ökonomie (IPÖ) am Otto-Suhr-Institut, Stöppler über Unternehmensnetzwerke am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Beide haben eine halbe Stelle, glücklich schätzen sie sich trotzdem. Stöppler ist Anfang 30. Begonnen hat er seine Promotion 2008 in einem Graduiertenkolleg. Diese Schulen sind stärker strukturiert als eine Individualpromotion. Mit gemeinsamen Kursen und Forschungen ähnelt diese Promotionsform einem fortgesetzten Studium. „Das System bietet viele Vorteile“, sagt Stöppler. So gebe es statt eines Betreuers ganze Betreuungsteams. „Ein einzelner Professor kann schließlich nicht in allen Themen ein Experte sein.“
Doch auch an den Graduiertenschulen ist die Förderung ein Problem: Die Promovierenden haben keinen arbeitsrechtlichen Schutz, da die Stipendien eine Schenkung sind. Wer Pech hat, bekommt nach einem Jahr einfach keinen Anschlussvertrag. Meistens würden die Stipendien zwar fortgesetzt, sagt Stöppler. „Aber krank werden kann man sich nicht leisten.“ Denn die Finanzierung werde nicht verlängert – „wenn dir ein halbes Jahr fehlt, fehlt es.“ Stöppler ist nach drei Jahren im Graduiertenkolleg seit 2011 am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft angestellt. In seinem fünften Promotionsjahr hat er den fünften Vertrag mit der FU. Für ihn waren das fünf Mal Hoffen und Bangen, ob er sich im kommenden Jahr noch finanzieren kann. Er sagt, er hatte Glück: „Ich kenne Doktoranden, die hatten in vier Jahren zehn verschiedene Verträge.“
Mauersberger promoviert am Lehrstuhl IPÖ über Medienregulierung in Lateinamerika. Er geht also den klassischen Weg der Individualpromotion. Fragt man ihn nach seiner persönlichen Situation, kommt er ins Schwärmen: „Ich kann zu einem Thema forschen, das mich interessiert und werde dafür bezahlt.“ Ihm gefällt die Kombination aus Lehre und Forschung. Und er mag die Freiheiten einer Individualpromotion. Seine Betreuerin unterstütze ihn, fordere, aber überlaste ihn nicht.
Fragt man ihn jedoch nach den strukturellen Bedingungen, klingt sein Urteil anders. Wer frisch von der Uni komme wie er, freue sich über das Gehalt. „Aber ich kenne genug Leute, die eine Familie gründen wollen oder keine günstige Wohnung haben – dann kann es knapp werden.“ Auch die Perspektiven der Nachwuchswissenschaftler sind nicht rosig. „Unbefristete Stellen haben nur die Professoren“, sagt Mauersberger. „Alle anderen erhalten Zeitverträge und hoffen, dass irgendwann irgendwo eine Professur ausgeschrieben wird, die nicht schon intern vergeben ist.“
Nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz dürfen wissenschaftliche Mitarbeiter, die nicht durch Drittmittel finanziert werden, maximal sechs Jahre lang auf Basis befristeter Verträge arbeiten. Dann müssten sie unbefristet angestellt werden – theoretisch. Praktisch müssen viele vorher, spätestens aber dann, gehen. Ihre größte Hoffnung: Weiter an der Uni als Juniorprofessor arbeiten – wieder befristet. „Du bist promoviert, Anfang 30 und willst eine Familie gründen. Und du weißt: Es wird nicht besser, sondern schlimmer“, beklagt sich Stöppler. Ein Witz unter Doktoranden geht so: „Und, was machst du, wenn du fertig bist?“ Antwort: „Anderer Job oder anderes Land.“
Wer in Deutschland im Wissenschaftsbetrieb arbeiten will, hat Überstunden ohne Ende, dazu Geldsorgen und unsichere Zukunftsaussichten. Wozu all diese Faktoren im Zusammenspiel führen ist absehbar und hat sogar schon einen Namen: „Brain Drain“ – das Abwandern qualifizierter Arbeitskräfte ins Ausland, wo sie besser bezahlt werden und eine Perspektive haben. „Und das fängt gerade erst an – im großen Stil“, sagt Stöppler. Er selbst will in der Wissenschaft bleiben. Er weiß, dass er dafür regional sehr flexibel sein muss. Trotzdem: „Es ist der Job, in dem du dich am besten selbst verwirklichen kannst.“
Professor Brittnacher nennt das „pädagogischen Idealismus.“ Der Impuls dabei: die Wissenschaft voran bringen und sie anderen Menschen vermitteln. Die meisten Doktoranden besitzen diesen Idealismus, vor allem in den Geisteswissenschaften, wo der Nutzen eines solchen Titels fraglich ist. Promovierende, denen es um die Wissenschaft geht, plagiieren nicht.
Deswegen trifft es sie, wenn einige „Titelhascher“ den Ruf des Doktors beschädigen. „Wir Wissenschaftler besitzen nicht viel“, sagt Professor Brittnacher. „Ich habe nur meine Redlichkeit und mein intellektuelles Kapital.“ Das werde ihm durch Plagiatsskandale genommen. Insofern hatte sogar die Causa Guttenberg und die jüngste Debatte um FU-Honorarprofessorin Anette Schavan ihr Gutes: Das Plagiieren ist eine zu ahndende Straftat geworden – es ist Diebstahl. Aber vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um auf die alltäglichen Sorgen der Doktoranden um Arbeit und Zukunft aufmerksam zu machen.