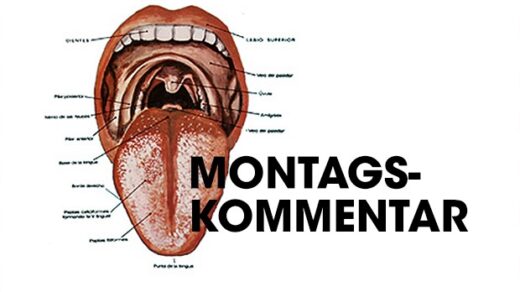Die Hochschulverträge sind ausgehandelt: Wenn die FU ihre Studierenden zum Turbo-Studium anhält, steht ihr mehr Geld zur Verfügung. Es hagelt Kritik. Von Lior Shechori und Max Krause

Illustration: Luise Schricker
Aufmerksame Erstsemester strömen in die Einführungsveranstaltungen. Sie wollen alles Wichtige über die Uni erfahren: wie man sich für Kurse anmelden kann und wo die Mensen sind. Zu hören bekommen sie erst einmal etwas anderes: Wir erwarten von dir, dass du deinen Bachelor in sechs Semestern schaffst, höchstens in sieben. Wer in Regelstudienzeit studiert, bringt der Freien Universität Geld ein. Pro Student zahlt das Land Berlin eine Kopfpauschale von mehreren tausend Euro. Bleiben Studierende länger als die vorgesehene Semesterzahl, bekommt die Uni weniger Geld. So steht es in den neuen Berliner Hochschulverträgen für die kommenden vier Jahre. Kein Wunder also, dass die Uni ein schnelles Studium forciert.
Hochschulverträge gibt es in Berlin seit 1997. Zuvor bestimmte das Berliner Abgeordnetenhaus allein über die Zuwendungen an die Hochschulen. Als diesen immer mehr Selbstbestimmung eingeräumt wurde, sollten sie schließlich auch bei ihrer Finanzierung mitreden dürfen. Seitdem verhandeln die Berliner Hochschulleitungen alle vier Jahre mit dem Berliner Senat darüber, wie viel Geld in ihre Kassen fließt und wofür es eingesetzt werden soll. Gleichzeitig verpflichten sich die Unis, bestimmte Auflagen zu erfüllen.
„Ausdruck von Verachtung gegenüber der Wissenschaft“, nennt Lucas Feicht die jetzigen Verträge. Der Asta-Referent der FU kritisiert die Verhandlungen scharf. Präsident Peter-André Alt habe die Interessen der FU in den Verhandlungen nicht entschieden genug vertreten. Alt selbst wehrt sich gegen diesen Vorwurf: Der jetzige Vertragstext sei „das beste Ergebnis, das überhaupt möglich war“.
Tatsächlich sieht die Lage für die FU auf den ersten Blick nicht so schlecht aus: Die Mittel steigen. Ab nächstem Jahr gibt es 3,4 Prozent, bis 2017 sogar 11,5 Prozent mehr Geld vom Senat als noch 2013. Die Zuwendungen wachsen in diesem Zeitraum um knapp 30 Millionen an. „Ich bin mit den Verträgen sehr zufrieden“, sagt auch SPD-Frau Sandra Scheeres, die als Berliner Wissenschaftssenatorin die Verhandlungen geleitet hat. Im Rahmen des klammen Landeshaushaltes seien die Zuwächse ein großer Erfolg.
Doch das zusätzliche Geld ist auch dringend nötig: Die Energiekosten steigen und neue Tarifverträge im öffentlichen Dienst zwingen die Uni, mehr Geld für Personalkosten aufzuwenden. Das neue Geld wird höchstens reichen,
um anfallende Mehrkosten zu decken.
Anja Schillhaneck glaubt, dass nicht einmal dafür genug Geld da sei. Als wissenschaftspolitische Sprecherin der Grünen- Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat sie sich ausgiebig mit dem Vertragstext und der Lage an den Hochschulen auseinandergesetzt. Knapp 150 Millionen Euro zusätzlich bräuchten die Berliner Universitäten in den nächsten Jahren, um auch nur den Status Quo zu halten, haben ihre Berechnungen ergeben. Bekommen werden sie lediglich 122 Millionen. „Das wird sicherlich strukturelle Auswirkungen haben“, meint Schillhaneck. Es sei zu erwarten, dass die Unileitung die Lasten auf die Studierenden abwälzen wird, statt bei der Forschung zu sparen.
Präsident Alt möchte die Ängste vor einem Finanzierungsengpass und Kürzungen ausräumen. Die Gelder reichten aus, um die „Kernaufgaben“ der FU auf dem gleich bleibendem Niveau zu sichern. Jörg Steinbach, sein Kollege von der TU, vertrat im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses dagegen die Ansicht, das zusätzliche Geld könne das Niveau an der TU nicht sichern.
Asta-Referent Feicht bezweifelt, dass es an der FU anders aussieht: „Alt weiß ganz genau, dass das Geld nicht ausreicht, um den Status Quo zu halten.“ Dazu komme noch, dass durch die Verträge falsche Anreize für die Unileitung geschaffen würden: Sie ermuntern die FU, mehr Studierende in Regelstudienzeit durchs Studium zu schleusen.
Die Freie Universität bekommt keinen Festbetrag vom Land Berlin. Stattdessen hängt der Geldfluss davon ab, wie gut sich die Uni schlägt. 1,27 Milliarden Euro könnte die FU in den nächsten vier Jahren maximal bekommen. Davon sind ihr aber lediglich 35,4 Prozent sicher. Den Rest bekommt sie nur, wenn sie ihre Hausaufgaben macht. Die Faktoren, nach denen der Erfolg der Universität bemessen wird, umfassen unter anderem die Menge eingeworbener Drittmittel, den Fortschritt bei der Gleichstellung der Geschlechter und die Anzahl an Absolventen.
Die mit Abstand wichtigste Bedingung ist aber ein umstrittener Posten: die Anzahl an Studierenden in Regelstudienzeit. Davon hängt fast ein Drittel der insgesamt verfügbaren Mittel ab. Feicht hält es für „völlig falsch“, die Regelstudienzeit als Kriterium heranzuziehen. Auch Grünen-Politikerin Schillhaneck wendet sich deutlich gegen diesen Maßstab: Die Regelstudienzeit sei ursprünglich als Mindeststudiendauer gedacht gewesen. Einer „Perversion der Logik“ komme es gleich, sie nun zur Obergrenze zu erheben.
Senatorin Scheeres glaubt dagegen nicht, dass der Druck auf Studierende durch die Regelung steigen wird. Sie setzt darauf, dass die Hochschulen es möglich machen, alle Studiengänge in Regelzeit zu studieren. Doch versteht das FU-Präsidium so die Verträge? Alt hält die Regelstudienzeit für „einen der geeignetsten Indikatoren“, um Erfolg in der Lehre zu messen – weil er gut von der Hochschule zu steuern sei. Wie diese Steuerung aussehen kann, lässt er offen. Nach einer breit angelegten Offensive zur Verbesserung der Studierbarkeit klingt das jedenfalls nicht.
Vier Jahre lang gelten die neuen Verträge nun, dann findet die nächste Verhandlungsrunde statt. Kritiker glauben, dass es an der Zeit ist, die Hochschulfinanzierung grundsätzlich zu überdenken. Dass es jetzt überhaupt noch Zuwächse gebe, sei lediglich der Tatsache geschuldet, dass Berlin noch viele Bundesmittel für die Unis erhält, sagt Schillhaneck. Lange könne das nicht mehr gut gehen. „Es ist Zeit, einen dicken Strich darunter zu ziehen.“
Doch es geht den Kritikern nicht nur um Geld, sondern auch um den Prozess. „Der Begriff Verträge suggeriert, dass sich hier zwei gleichberechtigte Verhandlungspartner geeinigt haben“, sagt Asta-Referent Lucas Feicht. „Das ist aber nicht der Fall, der Berliner Senat sitzt immer am längeren Hebel. Er kann der Uni notfalls einfach den Geldhahn zudrehen.“