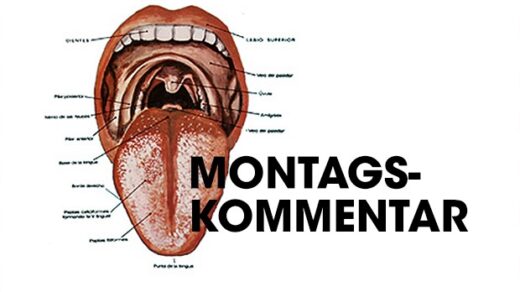Dem wissenschaftlichen Nachwuchs versprachen die Hochschulverträge der FU strukturelle Förderungen, doch davon ist noch nicht viel zu erkennen. Der Unmut wächst. Von Sophie Krause und Julian Daum
Etwa ein Jahr ist es her, dass FU-Präsident Peter-André Alt mit dem Land Berlin den Hochschulvertrag seiner Universität aushandelte. Darin wurden Vereinbarungen getroffen, die den Kleinstaat FU zu einem besseren, freundlicheren Ort für sein arbeitendes und studierendes Volk machen sollen. Die Klauseln versprechendie Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie und betonen Gleichstellungsaspekte. Auch der wissenschaftliche Nachwuchs soll gefördert und weitergebildet werden. Doch bei der Umsetzung all dessen gibt es Schwierigkeiten. Über die Probleme für Studierende haben wir bereits berichtet (Ausgabe 11). Ein weiteres großes Problem liegt im Mittelbau.
Bereits der erste Paragraph des Hochschulvertrages stellt der Uni eine Bedingung: die leistungsbasierte Hochschulfinanzierung. Erbringt die Uni in Bereichen wie Lehre, Forschung oder Gleichstellung verabredete Leistungen nicht, werden die Mittel der jeweiligen Leistungsbereiche um fünf Prozent gekürzt. Finanziell planen kann das betroffene Personal damit nicht. Gewinnen und Geld einsparen scheint bei diesem leistungsgebundenen Modell nur der Berliner Landeshaushalt. Als Verlierer des Hochschulvertrags hingegen fühlen sich viele. So sollen vier Millionen Euro bei den Personalkosten eingespart werden; Stellen werden gestrichen und Gehälter gekürzt. Konkret heißt das auch, dass weniger Personal mehr Leistung bringen soll.
Denn den großen Vorhaben des Hochschulvertrages steht ein altbekanntes Problem gegenüber: das Geld. Der Haushalt der FU setzt sich aus den Zuschüssen des Landes Berlin und Drittmitteln zusammen (siehe Infokasten). Ebenso wie das Land ist auch die Universität knapp bei Kasse und der Haushaltsplan der FU deshalb eng umrissen. Viel bewegen lässt sich mit dem Geld vom Land, das durch den Hochschulvertrag überwiegend zweckgebunden ist, nicht.
Das bekommen auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter (Wimis) zu spüren. Jüngst äußerten deren Vertreter im Akademischen Senat ihren Unmut. Ihnen versprach der Hochschulvertrag Planungssicherheit, Familienfreundlichkeit und nachhaltige Förderung. Bereits ein halbes Jahr nach Unterzeichnung des Vertrags fordern sie nun strukturelle Fördermaßnahmen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und des Qualifizierungsangebotes. Dieser Vorgang zeigt: Das Unbehagen im Mittelbau sitzt tief. Und das war auch schon vor den Hochschulverträgen so.
Dort, im Herz der universitären Lehre, sei die Lage „prekär“, fasst es Matthias Jähne, Hochschulreferent der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Berlin (GEW) zusammen. Durch den Hochschulvertrag sind die Arbeitsverträge der Wimis überwiegend auf drei bis fünf Jahre befristet, was aber seit längerem gängige Praxis ist.
Dies ist wohl auch der Grund, weshalb von der in den Hochschulverträgen versprochenen Planungssicherheit und Familienfreundlichkeit bei den Wimis nicht viel zu spüren ist. Zudem wurden im Mittelbau zunehmend Stellen gestrichen und häufiger an Promotionsstudenten als an promovierte Wissenschaftler verteilt. Diese haben überwiegend halbe Stellen, die sie für Lehrveranstaltungen, Vor- und Nachbereitung oder Sprechstunden aufwenden. Bastian Schlüter, Wimi am Institut für Deutsche Philologie, hält das für fatal. „Ich würde nicht sagen, dass man hier komplett ausgebeutet wird, aber es gibt schon diesen implizierten Modus, dass das wissenschaftliche Fortkommen Freizeit ist“, erklärt er.
Ein Lösungsansatz ist bereits gefunden: Den Mittelbau finanziert zwar die Uni, allerdings wird versucht, für Promotionsprogramme zunehmend Drittmittel einzuwerben. Das spart zwar eigenes Geld. Allzu große Hoffnung macht man sich im Mittelbau dennoch nicht. „Es gibt bei uns keine Frustration, aber so eine Art von negativer Entspanntheit. Man rechnet nicht mit viel“, sagt Schlüter.
Die Unzufriedenheit scheint auch an FU-Präsident Alt nicht vorbeigegangen zu sein. Immerhin kündigte er nach seiner Wiederwahl im April an, sich den Entwicklungsperspektiven des Mittelbaus zu widmen. Doch am Ende scheitert es womöglich wieder am Geld.
Infokasten
Insgesamt 510 Millionen Euro umfasst der Haushalt der FU. Er speist sich aus zwei großen Quellen: dem Hochschuletat des Berliner Senats und den sogenannten Drittmitteln. Letztere kommen entweder aus der Privatwirtschaft oder von öffentlichen Forschungsförderern wie Stiftungen und Vereinen. Vor allem die Industrie lässt sich Forschung viel kosten. In Deutschland stellt sie etwa zwei Drittel des Geldes zur Verfügung, das für Wissenschaft ausgegeben wird. Dabei handelt es sich ausschließlich um Förderung konkreter Projekte. Mit den Drittmitteln bezahlt die Uni jedoch weder Strom noch Gehälter, saniert weder ihre Gebäude noch kauft sie mit ihnen neue Geräte. Das nämlich leistet der eigentliche Etat der Uni. Er besteht aus Zuschüssen des Landes Berlin gemäß der Hochschulverträge, die Land und Uni alle vier Jahre neu verhandeln. Der Etat setzt sich aus einem konsumtiven und einem investiven Bereich zusammen. Der mit ungefähr 308 Millionen Euro größere konsumtive Bereich deckt die laufenden Kosten: Hausbewirtschaftung, Bauunterhaltung, vor allem aber die Personalkosten. Aus dem investiven Bereich, der mit 11,2 Millionen Euro veranschlagt ist, werden langfristige Investitionen finanziert. Mit diesen Geldern werden beispielsweise Neubauten, wissenschaftliches Gerät oder die IT-Infrastruktur bezahlt. Die Mittel reichen jedoch nicht aus: Die Investivausgaben bis 2015 belaufen sich auf rund 53 Millionen Euro. Um diese Kosten stemmen zu können, sollen zusätzlich Sonderzuschüsse des Landes oder Verkaufserlöse von Grundstücken helfen.