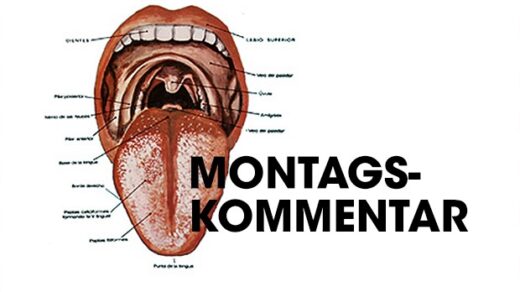Eine FURIOS-Leserin schildert, wie ein Kommilitone sie bedrohte und stalkte. Und was geschah, als sie die Uni um Hilfe bat.

Illustration: Freya Siewert
In einem Artikel in unserer Printausgabe des vergangenen Semesters heißt es: „Obwohl die FU nach außen vermittelt, ihr Möglichstes gegen sexualisierte Diskriminierung zu unternehmen, erleben viele Frauen diese auch im universitären Alltag.” Eine Studentin regte dieser Text dazu an, FURIOS einen Erfahrungsbericht zu schicken. Sie schildert, wie sie von einem Kommilitonen gestalkt wurde und sich auf der Suche nach Hilfe an die Psychologische Beratungsstelle der FU, ihr Institut und Kommiliton*innen wandte – erfolglos.
Wir veröffentlichen ihren Bericht, um das Thema sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an der Uni in die öffentliche Debatte zu bringen und sowohl bei der FU als auch uns Studierenden mehr Sensibilität für das Thema herzustellen.
Eine Stellungnahme der Psychologischen Beratungsstelle findet ihr im Anschluss an den Erfahrungsbericht.
Wintersemester 2013/14 an der FU. Eine Geschichte unter vielen
Ich wollte beginnen mit: „Es ist vermutlich nur eine Geschichte unter vielen“. Streichen wir das „nur“, denn es ist zu grauenvoll, als dass ich es selbst kleinreden sollte.
„Es ist vermutlich eine Geschichte unter vielen“. Dieser Satz an sich ist bereits grauenvoll.
Ich bin zum Studium nach Berlin gezogen. Ich kam mit Koffern zwischen IKEA-Regal, IKEA-Bett und IKEA-Schreibtisch an, komplett ohne Kontakte in der großen, neuen Stadt. Und ich hatte Glück, denn meine Kommiliton*innen waren super. Als Bachelor-Studentin an einem kleinen Institut der FU hatte ich schnell einen Kreis an vertrauten Gesichtern, ja Freunden, gefunden. Im zweiten Semester habe ich mit Freundinnen eine WG gegründet. Ich habe mich wohl gefühlt, war über verschiedene studentische Initiativen schnell Teil von Gruppen, Mitglied eines selbstorganisierten Cafés. Und dann habe ich L. kennengelernt.
L. war auch Student an dem Institut, hing auch in dem Café ab, in dem alle Studierenden ihren Kaffee tranken und ich frühstückte und zu Abend aß. Und so kam es, dass wir ihn zur Einweihungsfeier unserer WG einluden. Wir hatten den Küchentisch in mein Zimmer gestellt und mit Flaschen vollgestellt. Und wir hatten keine Anlage: wir hörten Radio.
Kurze Zeit später trennte er sich von seiner Freundin: Die beiden hatten zusammen gewohnt. Ich ließ ihn in überschwänglicher Hilfsbereitschaft ein Wochenende bei uns in der WG übernachten. Hals über Kopf und vermutlich unverantwortlicherweise (ich habe mir vorgenommen, kein victim blaming zu betreiben), bis er mich noch an diesem Wochenende eines Nachts – ich war um vier Uhr morgens auf dem Weg nach Hause – draußen auf der Straße an der Ecke abpasste: Er hatte auf mich gewartet, wusste ich, auch wenn er es nicht sagte – es war mitten in der Nacht und niemand sonst auf der Straße!
Er zog daraufhin aus, noch vor Ablauf des vereinbarten Wochenendes; er musste gemerkt haben, dass es mir gar nicht gefiel, aber wir redeten nicht darüber.
Irgendwann – oder irgendwie – hatte sich L. wohl in mich verliebt – es tut mir heute körperlich weh, es so zu schreiben.
Praktischerweise kurz vor dem Sommer. Ich hatte vor, zwei Monate zu verreisen. Ich konnte einfach weg. Unpraktischerweise: Ich hatte ihm mein Zimmer als Übergangslösung nach der Trennung untervermietet. Noch vor dieser Nacht, in der er auf mich gewartet hatte. Ich hatte ihm klargemacht, dass es nichts werden würde mit uns, dass es nie so gemeint gewesen war. Er hatte sich trotzdem getrennt, und er zog im Sommer in mein Zimmer.
Während ich schreibe, versuche ich victim blaming an mir selbst zu vermeiden. Ich versuche, zu vermeiden, darüber zu schreiben, ob ich nicht dumm war, ihm das Zimmer weiterhin zu überlassen. Ob ich nicht hätte sagen müssen, dass er mit seiner Freundin zusammen hätte bleiben sollen. Ich versuche zu vermeiden, zu schreiben, dass ich ihm wirklich keine Signale gesendet habe. Ich will nicht schreiben: Ich hatte einen Freund, und er wusste das, weil es absolut rein gar nichts ändert. Ich werde nicht mehr dazu schreiben, es wäre falsch, und es juckt mich doch in den Fingern, möglichen Kritiker*innen den Wind aus den Segeln zu nehmen, denn ich mache mich sehr verletzlich.
Vor meiner Rückkehr nach Berlin schrieb L. mir SMS und hinterließ Nachrichten bei Facebook. Ich antwortete nicht oder spät, und versuchte ihm klar zu machen, dass ich vorerst keinen Kontakt mehr wünschte. Die Nacht, in der ich gemerkt hatte, dass er stundenlang auf mich gewartet hatte, nicht nur zuhause, sondern draußen, war mir in die Knochen gefahren. Das wollte ich nicht, es beunruhigte mich, und ich wollte mich dieser Angelegenheit entledigen.
Und dann drehte er durch.
Er hatte den Schlüssel bei uns zuhause gelassen, und so musste ich ihn nicht einmal sehen, als ich Anfang des Wintersemesters 2013/14 wieder nach Berlin kam.
Dachte ich.
Noch einmal hatte ich ihm klarmachen müssen, dass es nichts werden würde, und dass er dabei war, sich in etwas zu verrennen.
Dann schrieb er mir eine SMS.
„Wann willste eigentlich deinen Zweitschlüssel wieder haben? ;P“
Es hatte nie einen Zweitschlüssel gegeben. Mir brach der kalte Schweiß aus: Bedeutete das, dass er einen Zweitschlüssel hatte anfertigen lassen? In dieser Nacht schlief ich nicht, diese Nacht verbrachte ich heulend hinter meinem Vorhang und spähte in den Hinterhof.
Die Drohungen gingen weiter, und ich wusste, er hatte bereits in einer Nacht auf mich gewartet.
Er wusste, wo ich wohnte.
Und er hatte darauf angespielt, dass er einen Schlüssel zu meiner Wohnung habe.
Mein Zimmer hatte kein Schloss: Ich nagelte nachts von innen einen Holzbalken vor die Tür.
Das ist wahr.
Ich versuchte, ihn zu vermeiden: das hieß, die Uni zu vermeiden. Ich schwänzte meine Kurse eine Woche lang. Doch ich konnte nicht länger zuhause bleiben, ich wollte keine Angst haben. Ich wollte lernen, dafür war ich doch hier.
Ich ging zur Uni. Und es ging weiter.
„Ich hätte dich gerne bei einer Performance dabei“, schrieb er, „du bringst den idealen Cocktail aus absurd geilem Körper und Abscheu gegen mich mit. Du würdest im knappen Bikini mit Rasierklingen an mir herumritzen so viel dir beliebt, während ich an einem Laptop meine Gedanken abtippe… +1000 andere Dinge, die die Aufmerksamkeit des Publikums vergewaltigen“
Und:
„Das ist nicht sehr klug. Du bezeichnest mich als Psychopathen. Dann verwehrst du mir den Weg des Zivilisierten. Es wurde überhaupt keine scheiß Grenze überschritten, ausser, dass du mich getreten hast, als ich am Boden lag. Du schickst Dr. Jekyll weg, dann bleibt Mr. Hyde… betrete Räume nicht, in denen ich mich aufhalte. Ich werde das selbe tun. Wenn du keine spektakulär peinlichen Szenen am Institut erleben willst, halte dich von jetzt an daran“
Ich hielt es nicht mehr aus, ich brauchte Hilfe. Ich erzählte meinen Eltern per Skype davon, dass mir jemand nachstelle, mir Angst mache. Aber ich las ihnen die Nachrichten nicht vor – sie sollten sich keine Sorgen machen um mich, allein in der Großstadt. Sie rieten mir nicht, zur Polizei zu gehen. Ich solle mich an jemanden von der Uni wenden.
Und gut auf mich aufpassen.
Ja, Mama.
Ich hielt es nicht mehr aus: Ich nahm allen Mut zusammen und bat um Hilfe. Ich beschloss, zur Psychologischen Beratungsstelle der FU zu gehen und erzählte die Geschichte, sagte dass ich Angst habe, dass er mir etwas antue, dass er mir auf dem Nachhauseweg auflauere oder mir an der Uni Schaden zufügen würde.
„Sie haben bisher seinen Namen noch nicht gesagt“, hat mir die Beraterin gesagt. „Es scheint, als ob sie ihn irgendwie schützen wollen.“
Sie hat mir nicht geraten, zur Polizei zu gehen, obwohl ich mit Tränen kämpfte, während ich ihr erzählte, obwohl sie die Taschentücher näher zu mir geschoben hatte – ich brauchte sie nicht. Ich war tapfer, wieso war ich tapfer? (Tapfere Mädchen weinen nicht.)
Aber hätte ich vor ihr weinen müssen, damit sie mir richtig zugehört hätte?
Ich hatte gesagt: Ich fühle mich nicht mehr sicher am Institut.
Ich hatte gesagt: Ich habe Angst, dass er mir auflauert.
Ich hatte gesagt: Er hat mir gedroht, „es würde etwas geschehen”, eben wenn wir uns an der Uni begegnen würden.
Ich hatte ihr gesagt: Ich habe die Nachrichten hier auf meinem Handy; und danach gegriffen, es auf den Tisch gelegt.
Sie hat sie nicht sehen wollen.
War es mein Fehler?
Ist es mein Fehler, auch jetzt noch die Schuld bei mir zu suchen?
Immer wieder habe ich mich gefragt, ob ich vielleicht vehementer hätte auftreten sollen. Ob ich doch direkt zur Polizei hätte gehen sollen. Aber wieso hat mir niemand nahegelegt, zur Polizei zu gehen? Wieso haben alle, an die ich mich gewendet habe, sich abgewandt? Ich habe in meinem direkten Umkreis an der Uni um Hilfe gebeten, und man hat mich hängenlassen. Es gab keine Zivilcourage, es gab niemanden, der mich auf Strukturen verwiesen hat, die mich geschützt hätten. Gab es die? Hätte ich mich an höhere Instanzen wenden sollen? Dazu riet mir niemand, und ich fragte und fragte, wie hätte ich wissen können, was ich tun sollte. Ich suchte nach Hilfe, und niemand half mir.
Ich hatte Angst, zur Polizei zu gehen, vor diesem großen Schritt, Angst, dass er der Uni verwiesen werden könnte, Angst davor, was das bedeuten würde – doch wieso, wieso machte ich mir darum noch Gedanken, als sei ich schuld – jetzt verstehe ich das nicht mehr.
Ich telefonierte mit der Opferhilfe Berlin und die sagten, es läge an den Verantwortlichen an der Uni, Schritte zu unternehmen, um mich zu schützen.
Eine Freundin, studentische Hilfskraft am Institut, informierte einen Professor. Der meinte: Wenn nicht direkt am Institut etwas vorgefallen ist, könne man nichts machen. Aber schlimm, schlimm.
Ich hatte Angst.
Musste erst etwas passieren?
Musste er mir erst wehtun?
Ich habe den Verantwortlichen des studentischen Cafés, auch er war ein Student, informiert und gebeten, L. zu verbieten, während meiner Schicht das Café zu betreten.
Er meinte: Ich kann ihm nicht verbieten, das Café zu betreten.
Auch er hat mir nicht geholfen.
Bei einer Aufführung in unserem Café trug L. eine Sturmhaube.
Mir wurde schlecht und ich kotzte ins Institutsklo.
Ich habe nach diesem Wintersemester hier keine Veranstaltungen mehr besucht, ich habe aufgehört, das Fach zu studieren, obwohl es mir Spaß machte, obwohl ich ganz gut war, obwohl ich nebenher schon praktisch in dem Bereich arbeitete. Irgendetwas hat mich davon abgebracht.
Seitdem habe ich Facebook gelöscht.
Fast macht es mir Angst, das zu schreiben, dass es gelesen werden könnte.
Von ihm.
Versuche ich, ihn zu schützen, indem ich seinen Namen nicht schreibe? Versuche ich, die Frau in der psychologischen Beratungsstelle zu schützen, indem ich ihren Namen nicht nenne? Wen schütze ich, wenn ich das Institut nicht benenne? Aber was würde es nun noch ändern?
Wer schützt mich?
Liebe FU, ich habe die Polizei nicht eingeschaltet, und ich werde es nicht tun.
Liebe FU, ich will niemanden beschuldigen.
Es ist an mir, mich selbst zu schützen, das habe ich gelernt.
Also muss ich schreiben: Schreiben, dass ihr mehr machen müsst, wenn ihr überhaupt etwas gegen sexualisierte Gewalt tun wollt. Denn es ist vermutlich eine Geschichte unter vielen. Ihr dürft nicht wegschauen. Gerade wenn ihr etwas machen wollt, müsst ihr hinschauen. An die Uni kommen täglich viele junge Menschen und einige brauchen Schutz.
Brigitte Reysen-Kostudis von der ZE Studienberatung und Psychologische Beratung antwortete auf eine Anfrage von FURIOS bezüglich des Verhaltens der Beratungsstelle in dem Fall der Studentin:
„Gerade bei Opfern sexualisierter Diskriminierung und Gewalt und auch bei Stalking ist es wichtig, die Ratsuchenden nicht unter Druck zu setzen, ihnen keinen Weg vorzuschreiben. Wir hören der/dem Betroffenen zu, geben Hilfestellungen zur Verarbeitung des Vorfalls und informieren über Möglichkeiten des Reagierens. Dazu gehört natürlich auch die Möglichkeit einer Anzeige. Unser Anliegen ist es dabei, dass sich die Ratsuchenden wieder als handlungsfähig erleben, also raus aus der Hilflosigkeit des Opfers hin zu – wieder – selbstbestimmten Handeln. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass eine Kollegin explizit zu oder gegen eine Anzeige bei der Polizei geraten hat.
In Stalking-Fällen verweisen wir darüber stets auf die Beratungsstelle StopStalking. An Weiterbildungsangeboten dieser Einrichtung haben sowohl mein Kollege Dr. Cugialy als auch ich teilgenommen, und wir sind daher mit deren Angeboten und deren Vorgehensweise bestens vertraut.”
Reysen-Kostudis verweist zudem auf eine Webseite auf der Anlaufstellen für Betroffene an der FU eingesehen werden können und eine FU-Richtlinie zum Umgang mit sexualisierter Diskriminierung und Gewalt.