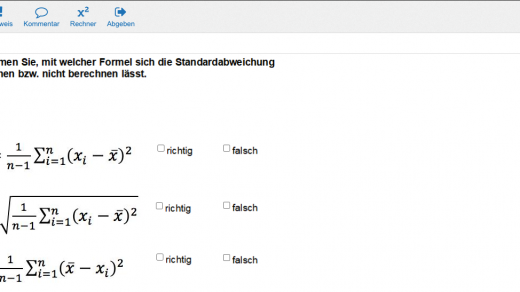In der Prüfungsphase werden die Klagelieder der Studierenden wieder laut: So viel Stress in so kurzer Zeit! Elias Fischer findet, die wirkliche Erschöpfung spüre man während der Grundausbildung.

In unserer Ferienserie „FURIOS verrenkt sich“ probieren unsere Autor*innen skurrile Sportarten aus.
Alle Semester wieder verwandeln sich die Uni-Gebäude während der Klausurenphase in Philharmonien. In jeder wiederholt sich das Programm – ein pompöser Chor voller Klagelieder. Der Bass brummt das Stöhnen der Resignation beim Lernen. Der Sopran quiekt die Hysterie des Aufwands. Der Alt erfleht die Belohnung der Bemühungen. Und der allgemeine Tenor: Alle sind vollkommen übermüdet und nicht mehr aufnahmefähig.
„Wenn der Motor lärmt, ist noch Benzin im Tank. Also hoch mit der verdammten Waffe!” Mit diesen Worten ermahnte mich ein Royal Marine während eines Ausbildungsabschnittes am Britannia Royal Naval College, weil ich stöhnend die ausgestreckten Arme langsam sinken ließ. Denn nach minutenlangem Halten des Gewehrs am Lauf schwanden die Kräfte.
Für den Befehlshaber zeigte sich wahre Erschöpfung und Müdigkeit erst in der Unfähigkeit, Geräusche von sich zu geben oder Bewegungen zu machen. Gelegentlich liegt mir diese Aussage von ihm auf der Zunge, wenn die Gesänge der Kommiliton*innen über den zu hohen Lernaufwand ertönen. Der Gedanke dahinter ist zwar barbarisch, aber auch nicht völlig falsch.
Schlafend in der Wachausbildung
Kurz vor 5 Uhr morgens ging es los mit Orientierungs- und Leistungsmärschen, Läufen über die Hindernisbahn und dem Kriechen im Feld – alles mit kompletter Ausrüstung. Zwischendurch vermittelte man uns Theorie zu medizinischer Versorgung, Navigation im Feld und den Strukturen des Militärs. Manche meiner Kamerad*innen waren so erschöpft, dass sie nach diversen Liegestützen regungslos am Boden verweilten, bis sie der Blick eines Vorgesetzten traf. Andere probierten ihr Glück im Unterricht, wo sie mit halboffenen Augen schliefen, bis sie erspäht wurden oder zu schnarchen begannen.
Aufnahmefähigkeit schien uns in diesen Wochen eine Utopie und trotzdem bestanden die Ausbilder*innen darauf. Schließlich standen zwischendurch Tests zur Wach- und Einsatzhelfer*innenausbildung sowie zu Vorgesetztenverhältnissen auf dem Plan. Also übten wir in jeder beaufsichtigten Pause verschiedene Knoten, schulten uns in Dienstgraden und den rechtlichen Gegebenheiten des Schusswaffengebrauchs oder büffelten die Vorgehensweise bei schweren Verletzungen im Gefecht. Vorausgesetzt, das Gehirn sendete und empfing überhaupt noch irgendetwas. Gegen 23 Uhr war dann meist Zapfenstreich: Der Vorhang wurde endlich zugezogen und ein Tag der dreimonatigen Grundausbildung endete.
Denken statt Gehorchen
All diese Ausbildungsinhalte erhoben keinen sonderlich hohen geistigen Anspruch. Der Drill schien wirklich die effektivste Methode zu sein. Aber selbst dieser geringe Anspruch forderte aufgrund der körperlichen Überbelastung die Fähigkeit zum Widerspruch als Tribut. Meine vage Vermutung: Das Ziel der Ausbilder*innen lag darin, uns zu stumpfsinnigen Automaten zu erziehen, die nur nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam funktionieren. Offiziell diente das natürlich nur der Steigerung der Leistungs- und Leidensfähigkeit sowie der Handlungssicherheit im Gefecht.
Weshalb ich den britischen Ausbilder nie zitiere: Ich führe eine Hassliebe zu derartigen Chören und finde es wunderbar menschlich, diese Klagelieder zu singen. Besonders der Tenor schafft eine wohlige, wenn auch in der Prüfungsphase hin und wieder überzogen jammernde Stimme, in der das eigene Leid ausgedrückt werden kann. Also seid weinerliche Querulant*innen, denn das zeigt, dass ihr nicht bloß funktioniert, sondern mitdenkt. Das soll bei Klausuren helfen!