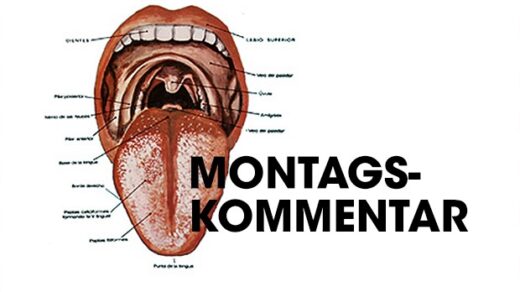Mit der Landflucht nach Berlin wurden auch die Besuche im Heimatdorf immer seltener. Jetzt stellt sich Rabea Westarp ihrer Abneigung gegen das Kaff – und stellt fest: So trostlos ist es hier gar nicht.

Das erwartete Gefühl der Trostlosigkeit, inmitten von angegrautem Putz und dunklen Backsteinhäusern im Ortskern, bleibt aus, als ich durch meinen Heimatort schlendere – ebenso wie das Gefühl, hier nicht willkommen zu sein. An diesem Nachmittag im August steht die Sonne hoch im Zenit und hüllt das 2000-Seelen-Kaff, in dem ich aufgewachsen bin und gelebt habe, bis ich 20 war, in ein ausgesprochen freundliches Licht.
Seit Weihnachten war ich nun nicht mehr hier. Das liegt zum einen daran, dass ich Heimatbesuche wegen der in Berlin antrainierten FOMO („fear of missing out“) stets auf ein Minimum zu beschränken versuche. Zum anderen haben auch meine Eltern dem katholischen Örtchen mittlerweile den Rücken gekehrt und Besuche bei meiner Mutter führen mich seit ihrem Umzug vor einigen Monaten nun zwangsläufig in den Nachbarort.
Allein unter Kühen
Meinen ersten Ortsbesuch als offizielle Touristin starte ich mit Hund an der Leine am wohl einzigen Hingucker, den das Dorf zu bieten hat: dem Schloss. Mutmaßlich im 12. Jahrhundert errichtet, liegt es inmitten von Wäldern, Bächen und der Gräfte; einem Wassergraben, der zu Mittelalterzeiten der Verteidigung und Abwehr von Feinden diente. Zwar riecht das stehende Gewässer etwas streng bei den hochsommerlichen Temperaturen, idyllisch ist dieses Fleckchen aber doch, zugegeben. Das Bild des malerischen Landlebens ist nahezu perfekt: Entlang des Spazierpfades weiden Kühe, Pferde und Schafe. Unter sie haben sich auch schnatternde Enten und Gänse verirrt. In einem Auslauf liegen Hängebauchschweine, die genüsslich grunzend die Sonne genießen.
Fast fühle ich mich, als würde ich durch eine Filmkulisse von Bibi und Tina laufen. Und als ich nach meiner Tour durch Wald und Wiesen in den Ortskern vordringe, bin ich überrascht, wie wenig schäbig und beengend er mit vorkommt. Das war vor meinem Umzug in die Großstadt anders.
Das Surreale an meinem etwa einstündigen Spaziergang: Mir begegnet im ganzen Dorf keine Menschenseele. Ob es an der Hitze liegt, dem zugegebenermaßen mauen Angebot von Freizeitaktivitäten und Einkaufsmöglichkeiten oder der Mittagsruhe, die man hier auf dem Dorf penibel einhalten sollte, wenn man es sich nicht mit den Nachbarn verscherzen möchte: Nirgends schneiden Menschen ihre Hecken oder mähen den Rasen – beides hatte ich insgeheim als Lieblingsbeschäftigungen der Dorfbewohner*innen verbucht –, nirgends bellt ein Hund, nur hin und wieder fahren Autos vorbei.
Ruhe in Frieden, Dorfleben
Auf dem Friedhof nahe der katholischen Kirche endet mein Spaziergang. Der Hund ist müde und legt sich erschöpft vor den überschaubaren Urnengräbern nieder – Feuerbestattung ist hier mehr Ausnahme als Trend. Nun passiert es doch noch: Uns begegnen Menschen. Zwei ältere Damen pflegen in verschiedenen Ecken des Friedhofs Gräber.
Nach einer Ruhepause kreuzen wir ihren Weg und ich grüße gewissenhaft, wie sich das gehört: Die Jüngere zuerst. Für Dorfkinder eine nahezu lebenswichtige Regel, wenn man sich nicht den Ruf der unhöflichen Göre einhandeln will.
Als ich am Wegrand ins geparkte Auto steige, ziehe ich mein Fazit: Der Groll, den ich gegen dieses aus meiner Sicht weltferne und triste Kaff meine gesamte Teenagerzeit gehegt habe, scheint verflogen zu sein. Stattdessen habe ich meinen Frieden geschlossen mit dem 24 km² großen Fleckchen Erde und der unleugbar schönen Natur drumherum. Nur mit dem Dorfleben werde ich wohl nie mehr warm werden. 20 Jahre sind genug.