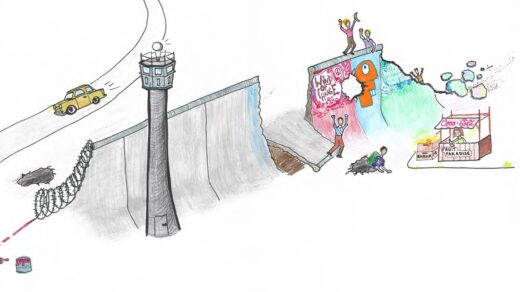Ost- und westdeutsch – sind das 30 Jahre nach dem Mauerfall noch brauchbare Kategorien? Quoten-Ossi Antonia Böker und Westfalen-Emsland-Zögling Elias Fischer sind da unterschiedlicher Meinung.
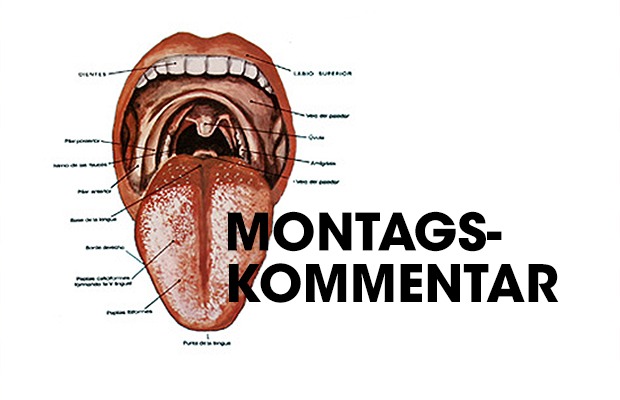
Wie einer aus dem Emsland zog – Elias
Ich packe meinen Koffer. Ich packe ein: Schallplatten mit West-Mucke; Telefon mit Tasten statt Drehscheibe; und Bananen. Was unternimmt man nicht alles, um als fortschrittlicher Wessi, wie ich als Westfalen-Emsland-Zögling, erfolgreich Ossis zu missionieren und seine Vormachtstellung aufrechtzuerhalten.
Ok, gelogen. Trotzdem muss ich gestehen, dass der Spannungsbogen in mir wuchs, als ich erstmals für eine längere Reise packte, bei der ich definitiv auf Ossis treffen sollte. Denn 2011 verschlug es mich zur Bundeswehr. Die sei bei Menschen der neuen Bundesländer ein beliebter, weil sicherer Arbeitgeber. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt nie bewusst jemandem aus der ehemaligen DDR begegnet war, fühlte ich mich verpflichtet, zwischen mir, dem Wessi, und Ossis zu unterscheiden.
Trabis und Kiwis mit Schale
In meinem Umkreis hielten sich Mythen, dass die Stimmbänder der Ossis degeneriert seien, weshalb sie alle sächseln; dass viele morgens vor dem Spiegel der Partei noch recht geben. Dass sie einfach eigenartig seien. So traf ich auf den ersten Ossi, der grüne Kiwis mit Schale aß; auf den zweiten, der vom Trabant 601 schwärmte. Beides erschien mir in meinem Kosmos bescheuert und typisch ostdeutsch, weil ich das nicht kannte.
Ändern sollte es sich, als ich mich mit dem ersten Kameraden anfreundete und erst später erfuhr, dass er aus Meck-Pomm stammte. Er wies keinerlei Symptome auf. Er sprach dialektfrei; schwärmte nicht für Lokomotive Leipzig oder Carl-Zeiss Jena – dennoch war er Ossi. Aber es erschien nicht mehr eigenartig. So verbrachte ich immer mehr Zeit mit Kameraden*innen aus den neuen Bundesländern.
Ich entdeckte den pappigen Charme eines Trabanten; verliebte mich in Vereinsnamen wie Traktor oder Chemie. Mein Wessi-Imponiergehabe ebbte nach und nach ab. Ich kreuzte die Finger nicht mehr für die West-Coast und stand zu meiner Liebelei mit Rap aus Ostberlin.
Anlass zur Selbstreflexion
Mittlerweile bin ich 26 Jahre alt, habe Menschen aus allen Teilen Deutschlands und der Welt getroffen. Bei allen stelle ich immer wieder sprachliche, habituelle oder sonstwie geartete Eigenarten fest. Aber die Leute, denen ich begegnet bin, haben mir immer stärker aufgezeigt, dass gerade ich viel Bizarres in mir trage. Doch niemand tat das, um sich bewusst von mir abzugrenzen, sondern um mich kennenzulernen, mich zu verstehen. Das fühlt sich wunderbar und menschlicher an, als die Differenzen auf die Goldwaage zu legen.
Jetzt, da ich in Berlin lebe und an der FU studiere, wo die Menschen aus allen Winkeln der Erde zusammenströmen, stellt sich die Frage nach der Herkunft nur noch bedingt: Meist stellt sie sich bei Vergleichen vom Dorf- und Landleben. Für mich ist die Ost-West-Unterscheidung heutzutage unnötig und abgehoben. An der FU tangiert das scheinbar auch niemanden mehr. Dass es für mich so ist, liegt vor allem auch an tollen Ossis, die keine Mauer zwischen sich und mir hochgezogen haben, sondern mich persönlich um ein großes Stück weitergebracht haben.
Halbgar ostdeutsch – Antonia
Ab und zu werde ich in Berlin gefragt, ob ich mich als Ostdeutsche sehe. Meine Antwort ist stets nein. Dann bin ich auch oft verleitet, zu verneinen, wenn es heißt: „Ossi und Wessi – ist das noch zeitgemäß?“ In meinem Freundeskreis und auf WG-Partys bin ich designierter Quoten-Ossi. Immerhin bin ich in Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen, habe dort mein erstes Bier getrunken und das erste Mädchen geküsst. Vom Leben im Osten habe ich ein gutes Bild – dabei bin ich selbst Import-Ossi. Quasi im Mutterleibe verschleppt worden, aus NRW ins Land der Frühaufsteher*innen. Da war die Mauer längst gefallen.
Vielleicht ist gerade das schon bezeichnend: Als wir nach eine*r Autor*in für diesen MoKo suchten, war ich die einzige Option – als bestenfalls halbgarer Ossi. Ich bin in Wittenberg aufgewachsen, habe Freunde besucht in Halle, Klassentrips gemacht nach Dessau und Bitterfeld. Als ehrlich ostdeutsch sehe ich mich trotzdem nicht.
Wie es ist, nicht wie es sein soll
Ossi zu sein ist nämlich keine Einstellungssache, auch nicht die gruselige lokalpatriotische, geschichtsferne Selbstzuschreibung der “Islamkritiker”. Sondern eine strukturelle, historisch bedingte Tatsache. Man sollte nicht Ist- und Soll-Zustand verwechseln: Faktisch gibt es zahlreiche strukturelle Überbleibsel aus der Zeit der Teilung. So lange es sie gibt, sollten sie auch benannt werden – denn nur dann bleiben sie sichtbar.
Ich habe es früher immer so gesehen: Für mein Rederecht als Ostexpertin habe ich bezahlt mit meiner Jugend inmitten von Graubeton, unterfinanzierten Schulen und einer Freizeiteinrichtung nach der anderen, in der die Lichter ausgingen. Weil meine Eltern sich entschieden hatten, hier zu leben, dachte ich: Ich musste das mitmachen. Obwohl ich nicht gemusst hätte. Musste – denn auch das war eine Jugend im Osten – Lehrer*innen zuhören, die sich die DDR zurückwünschten und Klassenkamerad*innen, die später der AfD beitraten. Mit klopfendem Herzen im Stadtpark und in der Regio an waschechten Springerstiefel-Nazis mit kahlen Köpfen vorbeigehen.
Das mit den Ossis ist noch nicht abgehakt
Aber haben die Leute, deren Eltern und Großeltern schon hier aufwuchsen, das alles mehr verdient? Ich bin im Osten ziemlich westdeutsch aufgewachsen. Habe nie gelernt, was „Viertel irgendwas“ bedeutet, und meine „i“‘s immer überbetont, war vor allem ziemlich privilegiert. Finanziell und ideell: Viele meiner Mitschüler*innen sind nicht im gleichen Osten groß geworden, wie ich. Niemand in meiner unmittelbaren Familie wurde bespitzelt, oder konnte nicht studieren, weil der Vater nach vier Bier über Erich gewitzelt hatte. Alles, was ich musste, mussten sie, die Ossis, auch – und mehr. Was das bedeutet, sollten wir (noch) nicht vergessen.