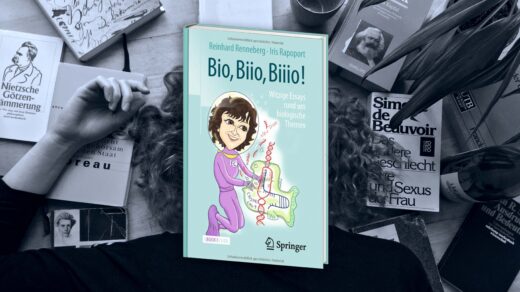Fast ein Jahr Onlineuni: Wie wirkt sich das auf ein Medizinstudium aus? Drei Charité-Studierende haben mit Clara Baldus und Greta Linde über Blockunterricht, Online-Kurse und die Arbeit im Testzentrum gesprochen.

Schon in der ersten Woche des neuen Jahres meldete Berlin einen neuen Höchststand an Corona-Toten. Die Situation auf Berliner Intensivstationen ist angespannt. Seit Ende November zeigt die Corona-Ampel für die Intensivbettenbelegung Rot an. An der Charité herrscht Notbetrieb, es wurde ein striktes Besuchsverbot erlassen. Doch wie beeinflusst die Corona-Pandemie das Studium an der Charité und wie erleben die Nachwuchsmediziner*innen den Ernst der Lage?
Antje, 21, studiert im 9. Fachsemester
„Unser Studium besteht aus Vorlesungen, Seminaren und Praktika, in denen wir beispielsweise Mikroskopieren lernen. Außerdem haben wir noch KIT, das heißt Kommunikation, Interaktion und Teamarbeit sowie UHK, also Unterricht am Krankenbett. KIT und UHK sind sehr wichtig, weil wir lernen, mit Patient*innen umzugehen und zu erkennen, was sie haben und brauchen. Eigentlich muss man sowas regelmäßig üben, aber dieses Semester hatten wir UHK im Block. Das liegt daran, dass wir sonst ja andauernd getestet werden müssten, um ins Krankenhaus zu dürfen. Ich bin im November also eine Woche lang am Stück in die Charité gegangen. Das hat nicht gut funktioniert. Einmal war der Dozent krank, an einem anderen Tag haben wir statt mit Patient*innen nur theoretische Fälle mit Ärzt*innen durchgesprochen. An wieder einem anderen Tag hatte der Arzt, mit dem wir mitlaufen sollten, eine Schwangere mit Corona da. Das hatte natürlich Vorrang und wir konnten keinen Unterricht machen. Geprüft wird das Ganze trotzdem, was natürlich problematisch ist, wenn man kaum üben konnte. Was gerade allerdings gut läuft, sind die Vorlesungen und Seminare. Morgens arbeite ich in der Regel zwei bis drei Vorlesungen durch. In höheren Semestern ist die Hälfte davon ohnehin online, das kam uns jetzt zugute. Danach erledige ich noch die dazugehörigen Übungen auf unserer Lernplattform. Außerdem haben wir ein neues Fragenportal, in dem wir alte Prüfungsfragen besprechen und kommentieren können. Dass immerhin die theoretischen Formate funktionieren, macht alles etwas erträglicher.”
Eduart, 23, studiert im 8. Fachsemester
„Mir fehlt der Unterricht am Krankenbett am meisten, denn den habe ich gerade nur online. Dabei sehen wir uns Videos von echten Fällen an und besprechen sie mit unseren Dozent*innen. Das ist natürlich nicht dasselbe wie mit Patient*innen direkt zu interagieren. Neulich hatten wir einen Fall von einer psychischen Störung. Wir haben zwar ein echtes Patienteninterview angeguckt, aber gerade bei Depressionen und anderen psychischen Krankheiten ist es wichtig, präsent zu sein und den Leuten in die Augen zu schauen. Das können wir gerade einfach nicht richtig üben. Neben dem Studium arbeite ich im Coronatestzentrum. Seit anderthalb Monaten weise ich Leute ein und nehme Abstriche. Mein Sozialleben hatte ich vorher schon stark eingeschränkt, aber wegen des Jobs habe ich es auf ein absolutes Minimum reduziert. Ich habe keine Angst davor, selbst Corona zu bekommen, aber ich möchte auf gar keinen Fall meine Eltern anstecken. Bald werde ich mich impfen lassen können, aber auch danach bin ich natürlich noch vorsichtig. Im März mache in meine Famulatur, also eine Art Praktikum, in der Neurochirurgie. Ich bin optimistisch, dass das stattfinden wird und freue mich darauf.”
Lena, 21, studiert im 4. Fachsemester
„Auch inhaltlich ist das Coronavirus Gegenstand des Studiums. Gerade belege ich ein Modul zur Lunge und zu Sinnesorganen. Besonders in diesen Bereichen sprechen wir viel darüber und fragen uns: Was macht Corona mit der Lunge? Wieso sorgt das Virus dafür, dass Menschen nicht riechen können? Das Thema ist hochaktuell und hochspannend, alle Studierenden sind daran sehr interessiert. Zudem hat die Charité kurz vor Weihnachten per Rundmail die Medizinstudierenden gebeten, im Krankenhaus auszuhelfen, vor allem auf der Intensivstation. Dazu erklären sich auch viele bereit. Ich arbeite als Pflegehelferin in einem Krankenhaus. Die Anspannung dort ist extrem hoch, da Corona ein zusätzlicher Stressfaktor zum sowieso schon stressigen Alltag ist. Auch die Arbeit im Team ist belastet durch das ständige ‘Komm mir nicht zu nah’-Gefühl. Letztes Wochenende wurde ich erstmals auf der Corona-Station eingesetzt. Das war eine Überraschung für mich. Zu Beginn war mir etwas mulmig zumute, was mich dort erwarten wird. Es war extrem viel zu tun, besonders das aufwändige Anziehen von Schutzkleidung und das ständige Kommen und Gehen von Patient*innen war anstrengend. Die Belastungsgrenze ist definitiv erreicht, und das schon viel zu lange. Trotzdem war die Stimmung gut, ich konnte mit den Pfleger*innen offen kommunizieren und man hat auch mal ein Späßchen gemacht. Zu wissen, direkt damit zu tun zu haben, was gerade überall in den Medien ist, hat eine extreme Erwartung aufgebaut. Aber am Ende waren das alles Menschen, die Hilfe brauchen, wie ganz normale Patient*innen auch. Gerade jetzt Teil davon zu sein, bringt einen Mehrwert für mein Studium. Ich hoffe zwar, dass keine Pandemie mehr auf uns zukommt, aber Krisensituationen wird es in meiner Laufbahn als Ärztin sicherlich geben. Auch Patient*innen mit Infektionskrankheiten wird es immer geben. Daher sehe ich das als eine Art Vorbereitung und finde es gut, aktiv mitzuhelfen und zu versuchen, an der Situation etwas zu verändern.”