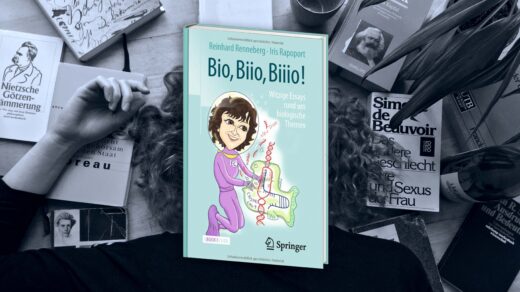Die Medizin überträgt an Männern beobachtete Forschungsergebnisse oft auf die ganze Gesellschaft – für Frauen kann das tödliche Folgen haben. An der Charité beschäftigt sich ein ganzes Institut mit der Bedeutung von Gendermedizin in der Arzneimittelforschung. Von Greta Linde und Maj Pegelow.

Männer vernachlässigen Depressionen und Osteoporose. Frauen ernähren sich besser, sterben dafür aber häufiger an einem Herzinfarkt. Medikamente wirken bei ihnen oft anders, weil ihre Körper kleiner und leichter sind. Trotzdem leben Frauen länger als Männer.
Genau damit setzt Turu Stadler sich in ihrem Arbeitsalltag auseinander. Seit gut einem Jahr leitet die Professorin an der Charité das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin. Deutschlandweit ist es das einzige, das sich explizit mit dieser Thematik auseinandersetzt. Stadler hat Psychologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt studiert und in Hamburg und New York gearbeitet. Dabei hat sie sich auf Gesundheitspsychologie und Geschlechter- und Paarforschung spezialisiert. Mittlerweile erforscht sie, welche Auswirkungen zum Beispiel Ernährung und Bewegung haben und welche präventive Gesundheitsmaßnahmen helfen können.
Dass Gendermedizin überhaupt relevant ist, hat Turu Stadler im Rahmen ihrer Doktorarbeit bemerkt. Bei der Themensuche stolperte sie über die Herzgesundheit von Frauen: „Mein Stereotyp war, dass Herzinfarkte eine Männerkrankheit sind.” Stadler wurde neugierig und begann, zur Vorbeugung von Herzerkrankungen bei Frauen zu forschen. Ein zweites ›Aha‹-Erlebnis hatte sie Anfang der 2000er Jahre, als sie für eine Studie in Luxemburg den Zusammenhang von früher Sterblichkeit, Geschlecht, sozialem Status und kognitiven Fähigkeiten untersuchte. Hier schnitten Männer mit geringen kognitiven Fähigkeiten wesentlich schlechter als andere Gruppen ab. Es gibt also auch innerhalb der Gruppe des eigenen Geschlechts Unterschiede.
Die Forschung ignoriert den weiblichen Zyklus
Dass diese Unterschiede existieren, bedeutet aber nicht, dass sie auch berücksichtigt werden. Das ist ein großes Problem für die Entwicklung von Arzneimitteln. Soll ein Medikament auf seine Wirksamkeit getestet werden, durchläuft es mehrere Phasen. Zuerst wird es in Petrischalen mit menschlichen Zellen in Kontakt gebracht. So testen Forscher*innen die Reaktion der Zellen auf das Arzneimittel. Schon in dieser Phase wäre eigentlich eine Differenzierung zwischen männlichen und weiblichen Zellen nötig, denn Forscher*innen fanden heraus, dass Zellen je nach Geschlecht verschieden auf äußere Einflüsse reagieren. Dafür müssen sie nicht mal mit Geschlechtshormonen in Kontakt stehen. So sterben weibliche Zellen eher ab, wenn sie beispielsweise mit Ethanol gestresst werden.
Ist diese erste Phase abgeschlossen, wird das Präparat für Tierversuche zugelassen. Hier macht sich die fehlende Berücksichtigung von Frauen weiter bemerkbar. Denn oft wird ignoriert, dass diese hormonellen Schwankungen unterliegen und je nach Zyklusphase anders auf Arzneimittel reagieren. So variiert innerhalb eines Zyklus’ zum Beispiel das Schmerzempfinden. Forscher*innen testen Medikamente zwar auch an weiblichen Mäusen – jedoch dann, wenn deren Hormonspiegel dem männlichen am ähnlichsten ist. Eine zyklusabhängige Auswertung ist deutlich aufwendiger, weshalb sie meist nicht durchgeführt wird.
„Das ist kein Hexenwerk“
Der dritte Schritt in der Arzneimittelentwicklung ist der Test am Menschen. Dieser beginnt, sobald ein Präparat die Tests an Tieren bestanden hat. Jedoch sind auch hier Frauen oft unterrepräsentiert. Dies liegt unter anderem am Arzneimittelskandal um das Beruhigungsmittel Contergan in den 1960er Jahren. Der enthaltene Wirkstoff Thalidomid führte in frühen Stadien der Schwangerschaft zu Wachstumsstörungen bei Föten. Um solche schwerwiegenden Pannen zu verhindern, wird seltener an jungen Frauen getestet. Die Folgen für Föten und Mütter in der Schwangerschaft oder Auswirkungen auf eine zukünftige Schwangerschaft werden in frühen klinischen Phasen meistens nicht geprüft. Obwohl Forscher*innen inzwischen häufiger Frauen in ihre Studien einbeziehen, werden Daten nur selten differenziert nach Geschlecht ausgewertet.
Dabei sei gerade eine Erhebung des Geschlechts und der sozialen Lage wünschenswert, erklärt Stadler: „Dadurch könnten wir viel besser sehen, wo es Probleme gibt und wo wir weiter forschen müssen, um bessere Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln.” Im Hinblick auf Covid-19 habe man gesehen, dass es auch ganz schnell gehen könne, Daten zu erheben: „Das ist ja kein Hexenwerk, allerdings ist das Umdenken in Deutschland zu langsam.”
Nur bei einem Drittel der Fruchtbarkeitsprobleme ist die Frau das Problem
Turu Stadler beklagt diese fehlenden Datensätze. Dass sie und ihre Kolleg*innen geschlechtsspezifische Unterschiede gar nicht einsehen oder entschlüsseln könnten, sei gefährlich. Besonders dann, wenn das Geschlecht und andere Merkmale, wie der sozioökonomische Status, zusammenspielen und auf die Gesundheit Einfluss nehmen: „Risikogruppen kann man so gar nicht erkennen. Wir müssen die Datenlage in Deutschland verbessern!”, fordert sie.
Zudem sei es problematisch, dass manche Themen, wie Verhütung oder Fortpflanzung, aus vermeintlicher Tradition Frauen zugeschoben würden. Die Rolle des Mannes werde hierbei in den seltensten Fällen erforscht. So gibt es bis heute keine medikamentöse Verhütung für Männer. Stadler ergänzt, dass es auch bei Fruchtbarkeitsbehandlungen Unterschiede gibt: „Es gibt zig Sachen, die Frauen tun sollen: abnehmen, sich gesund ernähren, mehr Bewegung, weniger Stress – aber über die Rolle der Väter wissen wir ganz wenig.” Und das sei kurios, denn nur etwa bei einem Drittel der Fruchtbarkeitsprobleme liege das Problem bei der Frau allein.
Deutschland hängt zurück
Andere Länder seien deutlich weiter, sagt Stadler. So sei es in den USA Standard, ethnische und sexuelle Minderheiten sowie Frauen in die Forschung einzubeziehen. In Kanada müssen alle Forschenden ihre Daten nach Geschlecht entschlüsseln, auch wenn die Forschungsfrage dies nicht verlange. Weshalb das in Deutschland nicht so ist, weiß die Professorin nicht. Kolleg*innen vermuten, es könne an Datenschutzbedenken liegen. Allerdings erhebt die Forschung oft deutlich sensiblere Daten als das Geschlecht, weshalb Stadler diese Begründung für eine Ausrede hält: „Ich glaube eher, dass es an der Repräsentation von Frauen liegt. An der Uni sind sie zwar als Studierende in den meisten Fächern noch stark vertreten, aber in leitenden Positionen unterrepräsentiert. Auf diesen Stellen fehlt oft das Interesse für diese Forschung.”
Die Unterrepräsentation liege unter anderem am Arbeitsalltag: „Die Medizin stellt hohe Anforderungen. Wenn ich eine Mehrfachbelastung habe, durch eine Familie oder die Pflege von Angehörigen – und das sind alles Aufgaben, die Frauen eher übernehmen – ist das problematisch.” Großbritannien mit seiner deutlich diverseren Forschungslandschaft ist für Stadler daher ein Vorbild. Hier hängt die Förderung mit öffentlichen Geldern davon ab, wie familien- und frauenfreundlich das Arbeitsumfeld ist. So finden beispielsweise keine Meetings zu späten Uhrzeiten statt. Durch solch banale Veränderungen hat sich die Forschungslandschaft verändert, mehr Frauen sind in Führungspositionen aufgestiegen. „Wir müssen Leute, die unterrepräsentiert sind, nämlich Frauen und Menschen mit Migrationserfahrung, in die Wissenschaft holen und dort halten”, fordert Stadler.
„Wir erleben einen wirklichen Generationenwechsel“
Wie wichtig diverse Forschungsteams und das Interesse an geschlechtsspezifischer Auswertung sind, beweisen zahlreiche Krankheiten: Ein Herzinfarkt zum Beispiel zeigt sich bei Männern und Frauen durch verschiedene Symptome. Männer haben meist Brust- und Armschmerzen. Frauen hingegen klagen über Bauchschmerzen, Kurzatmig-, Übel- und Müdigkeit. Diese Symptome werden jedoch als atypisch beschrieben, sodass sie seltener wahr- und ernstgenommen werden. Selbst wenn eine Herzkrankheit bei Frauen erkannt wird, haben sie in der Behandlung oft Nachteile: Sie erkranken meist in einem höheren Alter als Männer, Arzneimittel werden jedoch nicht in allen Altersgruppen getestet. Tritt eine Krankheit also in einem hohen Alter auf, kann es sein, dass (Neben-)Wirkungen von Medikamenten nicht ausreichend überprüft wurden.
Stadler ist „vorsichtig optimistisch, was die Zukunft angeht.” Andere Lehrstühle wenden sich inzwischen an ihr Institut und bitten um methodische Beratung für möglichst faire Forschung. Außerdem sieht der Lehrplan vor, Gendermedizin bereits ab dem ersten Semester zu lehren und auch im Zusammenhang mit anderen Fächern auf die Bedeutung geschlechtsspezifischer Unterschiede hinzuweisen. Auch die Offenheit unter den Studierenden sei sehr groß, was das Einschließen von Minderheiten oder Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen betrifft: „Wir erleben einen wirklichen Generationenwechsel. Es gibt eine höhere Sensibilität unter unseren Studierenden. Das ermutigt uns.” Aus Stadlers Sicht werde die nachkommende Generation viel in der Forschung verändern: „Es tut sich was”, sagt sie. „Es ist aber von uns allen abhängig, ob wir es gemeinsam schaffen.”