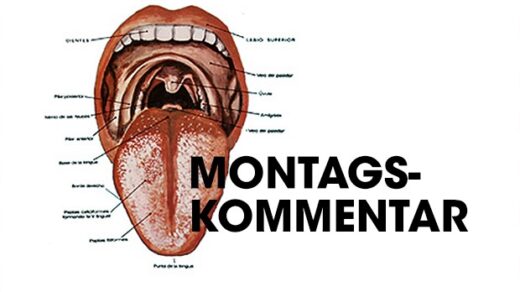122 Anträge in 15 Jahren: niemand sonst an der FU hat in den vergangenen Jahren so viele Drittmittel bewilligt bekommen wie Jürgen Zentek, Direktor des Instituts für Tierernährung. Im Interview mit Alena Weil erzählt er von seiner Arbeit, dem Einfluss von Drittmittelgebern und abgelehnten Projekten.

FURIOS: Herr Zentek, in den vergangenen 15 Jahren haben Sie laut Drittmitteldatenbank der FU 122 Drittmittelanträge bewilligt bekommen. Woran forschen Sie und wie haben Sie es geschafft, so viele Drittmittel für Ihre Arbeit einzuwerben?
Jürgen Zentek: Am Institut beschäftigen wir uns mit der Ernährung von Tieren und den Effekten auf den Darm und die Darmfunktion, insbesondere die Darmbakterien. Dabei interessiert uns, wie die Gesundheit der Tiere über die Ernährung beeinflusst werden kann. Unter anderem befassen wir uns mit Einflüssen der Ernährung auf Antibiotikaresistenz, also mit der Frage: Können wir die Menge der Antibiotikaresistenzgene im Darm durch bestimmte Fütterungsmaßnahmen reduzieren? In der Tierhaltung brauchen wir Alternativen für Antibiotika. Da ist es interessant, mal zu prüfen, ob Produkte wie Probiotika – also Milchsäurebakterien – eine ähnliche Wirkung haben. Letztendlich ist es immer die Ernährung und ihre Interaktion mit dem Verdauungssystem, die uns interessiert.
Was die Drittmittel angeht, das sind unterschiedliche Sachen: Wir hatten auf der einen Seite einige EU-Anträge, wir hatten einiges über die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und wir hatten nationale Forschungsprojekte. Das ist also ein ziemlicher Mix. Wir haben auch einiges an Industrieförderung gehabt, das sind häufig kleinere Projekte. Und das summiert sich eben.
Das Stellen von Drittmittelanträgen kostet allerdings häufig viel Zeit und Nerven – und geht damit zulasten von Forschung und Lehre. Wie ist das bei Ihnen? 122 bewilligte Drittmittelanträge, das hat vermutlich eine Menge Zeit gefressen?
Ja, klar. Aber über diese Mittel können wir wieder Leute beschäftigen, also Postdocs und Doktorand*innen. Insofern steckt man zwar einerseits viel Zeit in diese Anträge, kann aber andererseits den wissenschaftlichen Nachwuchs qualifizieren. Wir haben viele Studierende, die im Rahmen ihrer Dissertation in den Projekten arbeiten. Oder wir können auch für Postdocs mal eine Stelle finanzieren. Letztendlich dient Forschung nie als Selbstzweck, sondern ist immer auch ein Qualifikationsinstrument, das wir für die Ausbildung von jungen Mitarbeiter*innen nutzen.
Allerdings werden die Mittel nur für bestimmte Zeiträume bewilligt und man weiß nicht, ob die Förderung fortgeführt wird. Wie gehen Sie damit um – insbesondere, wenn Sie von dem Geld Mitarbeitende beschäftigen?
Das ist natürlich generell ein Problem, man kann keine Dauerförderung in Aussicht stellen. Aber für Doktorand*innen ist es eine Perspektive zu wissen, dass die Finanzierung für zwei oder drei Jahre gesichert ist und die Forschung und Lehre durchgeführt werden kann. Nach der Promotion können Absolvent*innen auch in die Praxis oder in die Wirtschaft gehen. Insofern sind Drittmittel, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit verfügbar, für die Qualifikation des Nachwuchses gut nutzbar .
Die Abhängigkeit von Drittmitteln hat allerdings auch ihre Kehrseite: Kritiker*innen befürchten, dass die Forschungsfreiheit beschränkt wird, indem Forscher*innen sich an den Themen ausrichten, die die größten Erfolgsaussichten auf Förderung versprechen. Wie schätzen Sie das ein und wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit damit um?
Ja, diese Kehrseite gibt es auch. Auf der anderen Seite hat man auch die Möglichkeit, Anträge zu eigenen Ideen zu stellen – selbst wenn diese erst einmal für die breite Masse nicht von zentralem Interesse sind – die man beispielsweise über die DFG platziert. Da kann ich auch, je nach Kapazität in der Arbeitsgruppe und Interessenlage der Mitarbeitenden, frei meine Themen suchen und meine Schwerpunkte setzen. Das ist vielleicht bei EU-Projekten ein bisschen anders, da bewirbt man sich in der Regel auf Calls, in denen viele Dinge vorgegeben sind. Aber da würde man sich ja auch nicht unbedingt bewerben, wenn das etwas wäre, das einen gar nicht interessiert oder meilenweit weg von den eigenen Fähigkeiten liegt. Also ich würde nicht sagen, dass man sich einschränkt.
Haben Sie es schon erlebt, dass Sie lange auf einen Antrag hingearbeitet haben, der dann nicht bewilligt wurde?
Das passiert leider auch. Und das ist gerade bei der EU-Forschungsförderung wirklich ein Problem geworden. Da bewerben sich teilweise 70 oder 100 Konsortien auf einen Call, da können Sie sich vorstellen, wie niedrig die Chance ist. Aber damit muss man eben leben, dass man im Wettbewerb um Mittel mit Projektanträgen auch scheitern kann.
„Dass man sich in seiner Forschung nicht vom Geldgeber beeinflussen lässt, ist selbstverständlich“
Im Zusammenhang mit Drittmittelforschung befürchten Kritiker*innen auch, dass Geldgeber – etwa Stiftungen oder große Unternehmen – Einfluss auf die Forschung nehmen könnten. Wie gehen Sie persönlich mit dieser Thematik um? Wann würden Sie eine Kooperation ablehnen?
Dafür haben wir ja rechtliche Grundlagen, und die finde ich persönlich gut und wichtig. Da wird geregelt, was publiziert werden darf und welche Verpflichtungen man eingeht. Und dass man sich darüber hinaus nicht beeinflussen lässt, ist selbstverständlich. Ich sehe das nicht als Gefahr. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass zum Beispiel Berufungen durch Drittmittelpartner beeinflusst worden wären. Berufungen sind akademische Entscheidungen, die fallen nach den vorgegebenen Kriterien, dafür haben wir ein striktes Regelwerk. Insofern halte ich es für völlig ausgeschlossen, dass da jemand von außen Einfluss nimmt. Das ist sehr streng geregelt, zum Glück.
Es gab allerdings bereits einige Fälle, etwa bei der HU und der TU Berlin mit der deutschen Bank, oder der Universität Mainz mit der Boehringer Ingelheim-Stiftung, in denen sich die Geldgeber Einfluss und Mitspracherechte, etwa bei Berufungen, gesichert hatten…
Ich bin mit den Beispielen nicht vertraut, ich gehe davon aus, dass es sich dabei um Stiftungslehrstühle handelte. Normalerweise gibt es kein Mitspracherecht. Wenn das eine Stiftungsprofessor war, dann müsste man schauen, welche Vereinbarungen da zwischen den Unis und der Stiftung getroffen wurden. Das sind dann Verfahren, wo die Stiftung auch größere Geldsummen zur Verfügung stellt und dann möglicherweise vereinbart wird, dass bestimmte Dinge im Fokus stehen. Aber das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich.
„Ich glaube nicht, dass im Hochschulbereich finanzielle Anreize das bewegende Momentum sind“
Drittmittel fördern auch die Konkurrenz in der Wissenschaft. Im Akademischen Senat der FU wurde Anfang des Jahres über eine leistungsbezogene Besoldung für Professor*innen diskutiert. Kritiker*innen finden, dass ein solches Konkurrenzdenken und diese Leistungsorientierung in der Wissenschaft fehl am Platz seien, andere wiederum erkennen darin eine Chance, Forscher*innen zu Höchstleistungen zu motivieren. Wie sehen Sie das?
Das Thema leistungsbezogene Besoldung ist sicherlich etwas, das man diskutieren muss. Leistung – das ist zumindest meine Erfahrung – ist im Hochschulbereich unglaublich schwierig zu messen. Da gibt es ganz unterschiedliche Leistungen, und das hinterher auf eine Wert runterzubrechen, das ist eine ganz schwierige Geschichte, da bräuchte man verbindliche Richtlinien. Und das ist auch wieder abhängig von der Fachkultur, man kann die Fächer nicht eins zu eins vergleichen.
Man muss das diskutieren und auch fragen: Warum? Was ist der Zweck? Was ist der Hintergrund, was will man damit erreichen und welche negativen Effekte könnte das haben. Da gibt es ganz viele Aspekte, meiner Meinung nach, positiv wie negativ – wie immer im Leben. Ich würde nicht von Vornherein sagen, das ist abzulehnen oder das ist gutzuheißen, sondern das ist einfach noch nicht hinreichend ausdiskutiert. Grundsätzlich denke ich, dass Leistung im Hochschulbereich sehr viel mit intrinsischem Interesse zu tun hat. Ob man tatsächlich dadurch einen Vorteil hätte, dass man Leistung anders honoriert, das kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, das ist nicht das bewegende Momentum. Jemand der so denkt, der würde eher nicht im universitären Bereich arbeiten, vermute ich mal. Denn dieser Bereich, der lebt ja ganz stark vom eigenen Engagement und von der Selbstmotivation. Davon, dass man sich für seinen Themenbereich interessiert. Ich glaube, dass das nicht so stark von finanziellen Anreizen abhängig ist.