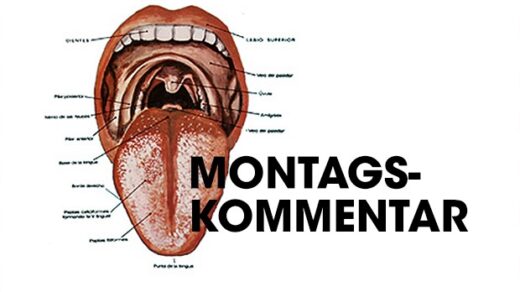Giftgas und Düngemittel scheinen auf den ersten Blick wenig gemein zu haben. Doch beide teilen sich denselben Erfinder. Ist er ein Massenmörder oder Held? Ein Essay über die Verantwortung von Forschenden und Ethik in der Wissenschaft von Luca Klander.

Mit einem lauten Zischen verbreitet sich Nebel über dem vernarbten Boden nahe des belgischen Dorfes Ypern. Als die Gaswolke über die Ränder der Schützengräben kriecht, macht sich Panik breit unter den Soldaten. Wer das Gas einatmet, sinkt zu Boden, um Luft ringend, sterbend. Am 22. April 1915 fallen 1200 Soldaten durch den weltweit ersten Einsatz von Giftgas. Es wird eine Waffe, die die grausame Art der Kriegsführung im ersten Weltkrieg entscheidend prägt. Erfunden hat sie Fritz Haber.
Der Wissenschaftler forschte am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin-Dahlem an Chlorgas und Phosgen. Er ist einer von vielen Forschenden, seine Erfindung eine von vielen wissenschaftlichen Durchbrüchen, die dem Institut seine große Bekanntheit brachte. Otto Hahn und Fritz Straßmann gelang hier die weltweit erste Kernspaltung. Die so erzeugte Energie erhöhte die Produktivität und schließlich den Wohlstand ganzer Nationen auf ungeahnte Weise. Doch zugleich sind die Folgen fatal: Sie legten den Grundstein zur Entwicklung der Atombombe, die 100.000 Menschen in Hiroshima und Nagasaki in den Tod riss. Heute befindet sich in den Gebäuden der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ein Teil der Freien Universität Berlin.
Bis heute wirkt die Arbeit von Forscher*innen, wenn auch in einem veränderten Kontext, in die Gesellschaft hinein. Wissenschaftler*innen sind in Talkshows zu Gast, beurteilen die aktuelle Politik, engagieren sich in Vereinigungen und werden in parlamentarischen Ausschüssen angehört. Damit steht immer auch die Frage im Raum: Inwieweit verpflichtet wissenschaftlicher Fortschritt? Müssen Forschende die Verantwortung für die Folgen, für den gesellschaftlichen Umgang mit ihren Erkenntnissen und Erfindungen übernehmen?
Das Fortschritts-Paradoxon
Fortschritt, darin steckt ›fortschreiten‹, eine Vorwärtsbewegung über den Status Quo hinaus. Besonders aus wissenschaftlicher Sicht wird der Begriff positiv bewertet, schließlich bedeutet Fortschritt das Erreichen einer höheren Entwicklungsstufe. Der ewige Kreis aus der Reflexion alter Thesen, dem Sammeln neuer Erkenntnisse und der Entwicklung neuer Theorien gleicht einer Spule, die sich immer in die gleiche Richtung dreht: nach vorne.
Doch die Frage, ob der ewige wissenschaftliche Fortschritt nun zum Guten oder Schlechten beiträgt, steht auf einem anderen Blatt. Die Antwort lautet wohl: Jein, sowohl als auch, es kommt darauf an. Für diese Ambivalenz gibt es viele Beispiele: Die Dampfmaschine als Grundstein der industriellen Revolution und Katalysator von Wohlstand und Innovation – aber auch von Umweltverschmutzung und Landflucht. Die Antibabypille als Ausgangspunkt der sexuellen Emanzipation – aber auch viel diskutiertes Präparat mit Nebenwirkungen. LSD mit dessen befreiender Bedeutung für die Hippie-Bewegung – aber auch gefährliches Rauschmittel. Und dann ist da natürlich noch das Internet.
Wie bitte? – Auch Kommunikation bedeutet Verantwortung
Vereinigungen wie die Scientists for Future sind Ausdruck der zunehmenden Bereitschaft, nicht nur fortschrittliche Ergebnisse zu liefern, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung dafür zu übernehmen und aktivistisch tätig zu werden. Von großer Bedeutung ist hierbei die verständliche Vermittlung. Berufspolitiker*innen reden gerne um die liquide, echauffierte Substanz, beziehungsweise den heißen Brei, herum. Bei Wissenschaftler*innen ist oft das Gegenteil der Fall. Sachverhalte werden in einer so präzisen Art und Weise – am besten mit lateinischen Fachtermini – erläutert, dass Laien meist nicht folgen können. Doch auch hier zeichnet sich eine Entwicklung ab, in der die Vorteile der medialen Vielfalt genutzt werden. Drosten-Podcast, MaiLab-Videos und die steigende Beliebtheit von populärwissenschaftlicher Literatur sind nur drei Beispiele. Zudem scheint die Bereitschaft, Einladungen in Talkshows zu folgen, gewachsen zu sein – obwohl in dieser Zeit auch geforscht werden könnte.
Publizieren oder Nicht-Publizieren?
Aber muss jede neue Erkenntnis mit der Öffentlichkeit geteilt werden? Diese Frage hat zwei Facetten: Zum einen, welchen finanziellen Nutzen Forschende aus ihren Erkenntnissen ziehen dürfen. Zum anderen, ob es Erkenntnisse gibt, die aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht, oder zumindest nicht genutzt werden dürften.
Die Aussage »Forschung und Erfindungen sollen dem Gemeinwohl dienen und folglich allen kostenfrei zugänglich gemacht werden«, setzt einen enormen Altruismus voraus. Denn die implizite Erwartungshaltung verlangt von Wissenschaftler*innen, auf Einnahmen durch ihre Arbeitsergebnisse zu verzichten. Gemeinnutzen oder geistiges Eigentum – die Frage ist mit Blick auf die vieldiskutierte Forderung nach der Patentfreigabe sämtlicher Covid-Vakzine aktueller denn je. Auch unter Studierenden würde ein kostenloser Zugang zu sämtlichen Publikationen sicher viel Anklang finden.
Was ist nun aber mit Erkenntnissen und Erfindungen, die Wissenschaftler*innen durchaus mit der Öffentlichkeit teilen wollen, aber nicht dürfen? Die Verwendung von Robotern in Kindergröße für therapeutische Zwecke bei Pädophilen ist beispielsweise aus moralischen Gründen verboten, auch wenn dies unter Umständen den Missbrauch an Kindern verhindern könnte. Zudem ist es mittlerweile möglich, eine ganze Spezies von Insekten genetisch so zu verändern, dass eine Übertragung von Malaria durch Moskitos verhindert werden könnte. Wegen des Risikos ungewollter Konsequenzen dieses Eingriffes in Ökosystem und Nahrungsketten blieb auch hier eine Realisierung aus. Ebenso gibt es im Bereich des Geoengineering innovative Forschung zur Bekämpfung des Klimawandels: Brächte der Mensch Schwefelpartikel in die Atmosphäre, könnte das die globale Temperatur um bis zu zweieinhalb Grad bis zum Ende des Jahrhunderts senken. Weil mit dieser Methode aber ein enormes Risiko für schwere Ozonschäden einhergeht, nahmen sämtliche Forschungsallianzen von der praktischen Umsetzung Abstand.
Vom Laborstuhl auf die Anklagebank
Bei diesen drei Beispielen war es womöglich noch leicht, sich auf eine Seite zu stellen. Doch insbesondere mit medizinischen Fortschritten im Bereich der Genetik wird eine ethische Beurteilung immer schwieriger und emotionaler. Das Grundgesetz spricht Wissenschaftler*innen das Recht auf die Freiheit in der Fragestellung, im Vorgehen und in der Verbreitung der Forschung zu. Gleichzeitig gewährleisten Ethikkommissionen, dass dies im Rahmen des Gesetzes geschieht. Bevor an Tieren oder menschlichen Stammzellen geforscht wird, müssen die Studien beantragt und genehmigt werden. Dennoch kommt es immer wieder zu Grenzüberschreitungen: Die Verurteilung eines Biophysikers zu einer Haftstrafe aufgrund von Genmanipulationen an Babys im Jahr 2019 in China ist nur ein Beispiel für die strafrechtlichen Konsequenzen auf diesem Gebiet. Sie rufen in Erinnerung, dass Wissenschaft, so sehr sie eine Gesellschaft verändern und weiterbringen kann, nicht auf Kosten der Moral praktiziert werden kann.
Doch nur selten sind die langfristigen Folgen direkt ersichtlich. Bei Erfindungen, die erst Jahre später ihre volle, mitunter nicht intendierte, Wirkung entfalten, ist es nochmals schwerer, die Urheber*innen vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen. Es herrscht das Narrativ des unbeholfenen Zauberlehrlings, der die Kontrolle über die selbst angestoßenen Entwicklungen verloren hat – nur gibt es in der Realität keine Rettung durch den Zaubermeister.
Fritz Haber war kein Zauberlehrling. Seine Forschung folgte der Prämisse: »Im Frieden der Menschheit, im Krieg dem Vaterland.« Das Leben des Chemikers war von der Schuld und von dem Segen, den wissenschaftliche Arbeit für die Menschheit bedeuten kann, geprägt wie kein Zweites. Dabei zog sich die Frage nach der ethischen Verantwortung wie eine rote Linie durch seine Biografie, leuchtete auf mit der tragischen Erfindung einer grausamen Waffe, wie auch mit seinem größten Verdienst an die Menschheit: Er entwickelte und erfand den Stickstoffdünger, ohne den die Menschen auch heute keine sichere Lebensmittelversorgung hätten und erhielt dafür 1918 den Nobelpreis. Noch im selben Jahr wurde er zum ›Vater des Gaskrieges‹ und indirekt verantwortlich für den lautlosen Tod von bis zu 100.000 Soldaten im Ersten Weltkrieg.