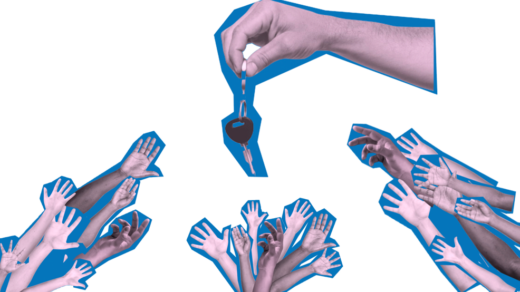Nie haben wir mehr Zeit in unseren Zimmern verbracht als in den letzten Monaten. Einrichtung ist das Statussymbol der Stunde. Berliner Studierendenzimmer bleiben aber monoton. Zeit für einen Appell, warum wir Einrichtungstrends trotzen sollten, findet Dune Korth.

In das erste eigene Zimmer außerhalb des Elternhauses zu ziehen ist ein Akt von Freiheit und Selbstständigkeit, es einzurichten ein Symbol von Emanzipation, vom Beginn eines Lebens fern von Kinderbüchern, Teenagergefühlen und Elternregeln. Es bietet die Möglichkeit, den eigenen Erinnerungen, der eigenen Ästhetik und dem eigenen Wohlbefinden Platz einzuräumen und so an Lebensqualität zu gewinnen. Einrichten macht außerdem Spaß – es ist ein kreativer Prozess, der im Idealfall die eigenen Vorlieben und den eigenen Geschmack vergegenwärtigt.
Viel zu oft wird dieser Prozess jedoch nicht von den persönlichen Bedürfnissen, sondern vom Urteil anderer abhängig gemacht. Dies führt zu einer uniformen Einrichtung, die Individualität nur noch in der Auswahl der eigenen Urlaubsfotos zulässt.
So scheint sich in der Berliner Studi-Szene aktuell eine lässige Mischung aus Baumarkt, Flohmarkt und Ikea durchgesetzt zu haben. Neben dem Bett, gezimmert aus von der Straße mitgenommenen Paletten, steht eine angeknackste Mid-Century-Kommode, die mühsam via U-Bahn durch halb Berlin geschleppt wurde. Von der Decke baumelt eine einzelne Glühbirne an einem stylisch bunten Kabel. Pflanzen in jeder freien Ecke verwandeln das Ganze in einen ›Urban Jungle‹, der immer ein wenig an ein Yoga-Video auf YouTube erinnert. Lichterketten und LEDs runden das Konzept ab und machen das Zimmer wunderbar dänisch ›hyggelig‹.
Außerdem essentiell für die aufstrebende Intellektuellen-Bohème: das Bücherregal. So wird im versammelten Freundeskreis heiß über den Inhalt des gerade aufgebauten BILLYs der Gastgeberin diskutiert – darf sich die zu Teeniezeiten verschlungene Twilight-Saga zu Uni-Lehrbüchern, Michel Foucault und Judith Butler gesellen? Oder wird sie zum Verstauben in den Keller verbannt? Was sagt ihre Existenz im Regal über die Bewohnerin aus?
Die Wohnraumeinrichtung wird so zu einem Statussymbol. Sie ist Ausdruck des Habitus einer sozialen Zugehörigkeit. Ein Aushängeschild, das Besucher*innen die gesellschaftliche Position und Sozialisierung der*des Bewohnenden verrät. Ein ordentliches, durchgestyltes Zimmer bedeutet: Ich habe mein Leben im Griff. Ich habe genug Geld, Zeit, Energie und Expertise, um alles präsentabel zu machen.
Die Pandemie hat dies paradoxerweise noch verstärkt – durch Homeoffice und Online-Seminare tritt plötzlich nicht mehr nur geladene Gesellschaft in die Privatsphäre ein. Zudem bombardieren Instagram, YouTube und Co. uns mit Bildern perfekt inszenierter Wohnoasen, die vor Selbstdisziplin und Repräsentativität nur so strotzen.
Dabei sollten die eigenen vier Wände der Ort sein, wo ohne Druck und Bewertung Entspannen, Nachdenken, kreatives oder unkreatives Chaos und auch schlechte Tage in Jogginghose möglich sind. Das eigene Zimmer ist der Inbegriff eines ›safe space‹, der ultimative Rückzugsort. Durch die ständige Bewertung von außen wird dieser jedoch zu einer Mischung aus Lebenslauf und unfreiwillig veröffentlichtem Tagebuch degradiert.
Wenn der Wohnraum also eine eigene, intime Umgebung für persönliche Entfaltung bleiben soll, dann müssen wir nicht nur lernen, auf uns selbst zu hören, um authentischer einzurichten. Wir müssen auch aufhören, zu viel in die Einrichtung anderer hineinzulesen und respektvoll mit der Einladung in die Privatsphäre umgehen.