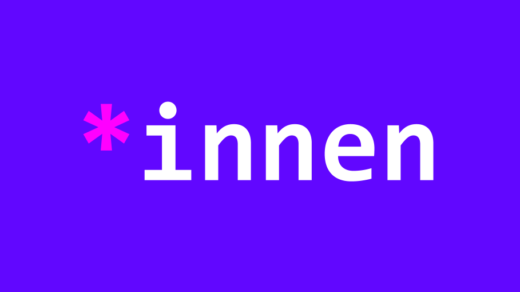Der Berufswunsch von Kindern und ob sie sich fähig fühlen diesen Beruf auszuüben, hängt maßgeblich von der verwendeten Sprache ab. Das zeigt eine neueste Studie. Lucie Schrage berichtet, warum sich der Kampf ums Gendern lohnt.

Egal ob Feuerwehrmann oder Krankenschwester – viele Berufe sind auch durch Sprache von Stereotypen besetzt, was sich schon im kindlichen Berufswunsch äußert. Der Beruf Arzt wird beispielsweise männlich gelesen und interpretiert, Arzthelferin meistens weiblich.
Kinder schätzen typisch männliche Berufe als erreichbarer ein, wenn die Sprache geschlechtergerecht gestaltet ist. Sprache prägt uns und damit unsere Wahrnehmung. Dries Vervecken, tätig am Karel de Grote University College, und Bettina Hannover, Professorin am Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie der FU, kommen in einer Studie zu diesem Ergebnis.
„Ich finde es bedauerlich noch immer geschlechtstypische Berufswünsche beobachten zu müssen”, sagt Hannover. Denn noch immer ergreifen Frauen seltener Berufe aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) als Männer. Dabei kann die Verwendung der männlichen und weiblichen Form bei Berufsbezeichnungen dazu führen, dass Mädchen und auch Jungen sich typisch männliche Berufe eher zutrauen.
Wie Sprache unsere Bewertung beeinflusst
Vervecken und Hannover befragten 591 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Dabei wurden den Kindern Berufsbezeichnungen vorgelesen, die entweder in männlich und weiblicher Form oder nur in männlicher Pluralform formuliert waren. Unter den 16 ausgewählten Berufen waren acht vermeintlich typisch männliche Berufe – bei Automechaniker*innen liegt der Frauenanteil beispielsweise unter dreißig Prozent. Außerdem nannten sie in ihrem Fragebogen fünf stereotypische weibliche Berufe, wie Kosmetiker*in, und geschlechtsneutrale Berufe. Die Forschenden stellten fest, dass Kinder sich Berufe eher zutrauen, wenn sie diese in geschlechtergerechter Sprache hören.
Eine weitere unschöne Erkenntnis zeigte sich: Die Kinder sollten ebenfalls einschätzen, wie viel sie in den Berufen verdienen und wie wichtig sie sind. Die Kinder hielten Berufe für weniger wichtig und schätzten sie als geringer bezahlt ein, verwendete man geschlechtergerechte Sprache.
Unsere Sprache zeigt also die tiefe Verankerung von Stereotypen. Dass wir diese Erkenntnisse immer wieder reflektieren sollten, möchte Hannover mit dieser Studie erreichen: „Die Leser*innen sollten sich überlegen in welchem Kontext sie als Multiplikator fungieren. Die Befunde in die eigene Sprachpraxis zu übertragen, muss erst gelernt werden.”
Der Plural ist nicht männlich
Der Grund für die Prägung unseres Sprachverständnisses ist das generische Maskulinum. Damit ist das grammatikalische Geschlecht – das Genus – gemeint.
Ein Beispiel des Grundkonfliktes: Ein Vater und sein Sohn sind mit dem Auto unterwegs und haben einen Unfall, bei dem beide schwer verletzt werden. Der Vater stirbt noch am Unfallort. Der Sohn wird ins Krankenhaus gebracht. Er muss sofort operiert werden. Der diensthabende Chirurg erblasst und sagt : „Ich kann ihn nicht operieren – das ist mein Sohn!” Was ist passiert?*
In der deutschen Sprache ist es Konvention, in der Pluralform das generische Maskulinum zu nutzen. So sollen bei der Bezeichnung Automechaniker Männer und Frauen gemeint sein. Ein Vorschlag der feministischen Sprachwissenschaft in Deutschland wie er z.B. im Buch Sprache und Sein von Kübra Gümüşay zu finden ist, lautet: Einfach immer die weibliche Form, also Automechanikerin, nutzen. Das Beispiel verdeutlicht, dass dies nicht aufgehen kann, denn in diesem Fall behauptet niemand, dass dieser Begriff auch Männer umfasst. Die Diskurse ums Gendern bleiben daher begründet und wir sollten es dringend – wie die Studie belegt – neben dem schriftlichen Gendern auch in unseren mündlichen Sprachgebrauch übertragen.
Lösung:
*Es handelt sich bei dem Chirurgen um die Mutter.