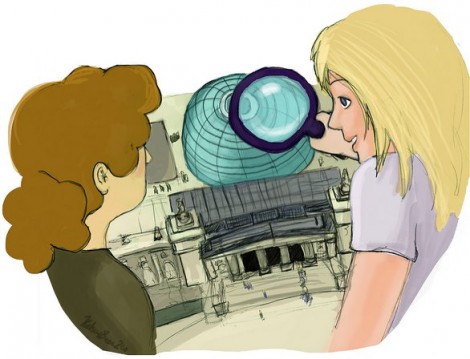Wenn man in Berlin Politik studiert, ist ein Praktikum im Bundestag sozusagen Pflicht. Fanny Gruhl und Margarethe Gallersdörfer haben ihre Eindrücke aus fünf Wochen im Bundestag gesammelt und verschmolzen. Eine Collage unter Wahrung fast aller Persönlichkeitsrechte.
Sie haben da so’n Fläschchen in der Tasche, das müssen Sie bitte mal rausholen“, sagte der Sicherheitsmann im Jakob-Kaiser-Haus. Wie bitte? Ich lächelte den Mitarbeiter meiner neuen Arbeitgeberin, der hinter der Schleuse schon auf mich wartete, nervös an. Ernst sah er zu, wie ich, völlig ahnungslos, in meiner Tasche wühlte und schließlich tatsächlich ein Fläschchen zu Tage förderte. Einen Kurzen. Kräuterschnaps. Ich hatte ihn am Wochenende zuvor aus Nettigkeit bei einem Junggesellinnenabschied gekauft und in meiner Tasche versenkt. Das durfte nicht wahr sein. Doch der Mitarbeiter winkte meine gestammelten Erklärungen lachend ab: „Schnaps kannst du hier ab und zu ganz gut gebrauchen.“
„Schau mal, wer da drüben ist!”
„Wir sagen übrigens alle Du zueinander.“ Aha. Eine sympathische Einstellung, die aber bisweilen unangenehm werden kann. „Hallo Frank-Walter!“ oder „Interessantes Kleid, Claudia!“ wäre mir sicher nur mit dem Schnaps über die Lippen gekommen. Zum Glück kam ich nie in die Verlegenheit.
Man versucht sich ja, wohin man auch kommt, so schnell wie möglich mit einer Aura routinierter Lässigkeit zu umgeben. Während alles um mich herum bei den Worten „Praktikum im Bundestag“ ganz hibbelig wurde und fragte, ob ich die Merkel schon gesehen hätte, bemühte ich mich ab dem zweiten Tag, durch die Flure zu segeln, als sei ich öfter da. Manchmal musste ich mir diese Aura wieder ins Gedächtnis rufen. Als ich in der Mitarbeiterkantine plötzlich ARD- Hauptstadtkorrespondent Ulrich Deppendorf gegenüber saß. Oder als ich mich gerade noch davon abhalten konnte, spontan Philipp Rösler zuzuwinken, weil mir noch rechtzeitig einfiel: Der kennt mich ja gar nicht.
Besuchergruppen – ein seltsames Völkchen
Neben Begegnungen mit bekannten Politikern sind mir auch die Besuchergruppen im Bundestag in lebhafter Erinnerung geblieben. Ob Damen eines deutschrussischen Kulturvereins, die sich in fragwürdigen Posen auf dem Sofa der Fraktionsebene – und auch überall sonst – ablichteten, Schulklassen, die mit erstaunlichem Wissen und kritischen Fragen auftrumpften oder einer Gruppe aus der Mongolei, die vor nichts zurückschreckte. Bei ihrem Versuch, sich neben den Schriftzügen sowjetischer Soldaten im Reichstagsgebäude zu verewigen, mussten ihnen die Wachleute Einhalt gebieten. Und warum nicht das Fraktionstelefon für einen kurzen Reisebericht in die Heimat nutzen?
Doch nicht nur das Verhalten der Besuchergruppen stellte sich als interessant heraus. Zu sehen, wie sich die Abgeordneten vor wählendem Publikum produzieren, war ebenfalls äußerst lehrreich. Da wird der bequeme Flug zwischen Wahlkreis und Berlin im Eifer der Selbstdarstellung schon mal zur anstrengenden Zugfahrt. Die Mitarbeiter, die mit der AirBerlin-Hotline schon per du sind, stehen dabei und sehen angestrengt zu Boden.
Wer Parteifreunde hat, braucht keine Feinde mehr
„Freund, Feind, Parteifreund“: Diese Steigerung lernte ich erst während meines Praktikums verstehen. Dass sich nicht alle lieb haben müssen, bloß weil sie in der gleichen Partei sind, war mir bekannt. Dass das Hauen und Stechen nicht erst beginnt, wenn die Partei an der Regierung beteiligt ist, überraschte mich aber. Wie wir seit Franz Müntefering wissen, ist Opposition doch sowieso Mist. Wäre es dann nicht sinnvoll, sich zusammenzuraufen und vereint auf die Regierung einzudreschen? Schnell ging mir auf, dass ich bisher etwas übersehen hatte: die enorme Eitelkeit der Damen und Herren Abgeordneten. Wessen Name wird unter der neuen Parteibroschüre zum Thema Bildung stehen und daraus folgend: Wer wurde bei der Entstehung der Broschüre übergangen? Haben Abgeordnete das Gefühl, dass ein Kollege oder eine Kollegin versucht, sich im Alleingang auf einem ihrer Themengebiete zu profilieren, werden die Telefonate zwischen den Büros ganz schnell giftig. Publicity ist alles, denn Parteifreundschaft hin oder her: Den Kopf in die ARD-Kamera halten kann am Ende des Tages nur einer.
Die netten “Anderen”
Wider Erwarten: Wolfgang Bosbach ist ganz nett. Plattitüde? Für mich nicht. Mein Weltbild ist ins Wanken geraten. Bosbachs Äußerungen bringen mich seit Jahren dazu, die Zeitung anzuschreien. Ein paar Stichworte: Vorratsdatenspeicherung, rechte Einwanderungspolitik, Anti-Terror- Gesetze. Für mich war klar: Dieser Mann muss ein … also, unsympathisch sein.
Irritiert blickte ich in meiner ersten Ausschusssitzung auf diesen gebräunten Rheinländer, der Witze reißt, parteiübergreifend den halben Ausschuss duzt und in einem unbeobachteten Moment heimlich seinen beiden Praktikantinnen, die neben mir sitzen, zuwinkt. Der, zur Freude aller Anwesenden, den nächsten Tagesordnungspunkt kauend über meine Schulter von meinem Blatt abliest, weil er sich grade am Snackwagen befindet statt auf seinem Platz als Vorsitzender. Dessen Website unter www.wobo.de zu erreichen ist. Liebe Welt, du warst so schön in schwarz und weiß!
Diskutieren mal anders
Die Diskussionen in Uniseminaren hatten mir im ersten Studienjahr nur selten Freude gemacht: Kommilitonen, die krampfhaft versuchten, dünne Redebeiträge in möglichst unverständliche Formulierungen zu verpacken, Theoretiker-Namedropping und ein daueraggressiver Tonfall. Überrascht registrierte ich im Bundestag völlig andere Umgangsformen. Plötzlich war meine Meinung gefragt! Meine Abgeordnete wollte gleich am Anfang von mir wissen, wie ich ihr Auftreten bewerte. Auch bei inhaltlichen Diskussionen wurde ich schnell wie selbstverständlich mit einbezogen und das Beste: Selbst harsche Kritik nahm niemand persönlich. Man traute mir etwas zu. In der ersten Woche: Sitzungen protokollieren, in der letzten: eine Plenarrede schreiben. Den Schnaps brauchte ich nicht.