Eltern, BAföG, Arbeit: Es ist nicht viel, aber ein bisschen Geld haben Studenten eigentlich immer. Wie es ist, überhaupt kein Geld zu haben, wollte Julian Niklas Pohl herausfinden. Er versuchte, in Berlin zu betteln. Ein Erfahrungsbericht.

Es ist neun Uhr morgens und die Bierauswahl eines Supermarkts am Nollendorfplatz lacht mich an. Ich rede mir ein, der Erwerb von zwei warmen Flaschen Oettinger zum jetzigen Zeitpunkt würde mir in meiner Rolle zusätzliche Authentizität verleihen – dass sie zu meinen mit Olivenöl gefetteten Haaren und den schwarzen Rändern unter meinen Fingernägeln passen. Doch eigentlich geht es um etwas ganz anderes: Ich möchte mir in diesem Moment gerne Mut antrinken.
Minuten später stehe ich mit vier Exemplaren des Straßenmagazins Motz unter dem Arm am U-Bahnsteig und warte auf die U12 Richtung Warschauer Straße. Die warmen Biere sind im Regal geblieben, ich will meine Angst hinunterschlucken und es ohne Alkohol versuchen. Meine Zeitungen habe ich aus einem kleinen Campinganhänger für 40 Cent das Stück erstanden. Jeder kann dort vom gemeinnützigen Verein Motz & Co e.V. vergünstigte Zeitungen kaufen, um sie dann weiterzuverkaufen. Das Vertriebskonzept sieht pro Exemplar einen Verdienst von 80 Cent für den Verkäufer vor.
Die Bahn kommt. Ich steige ein. Der Schritt kommt mir riesig vor. Die Türen schließen sich, die Bahn fährt an: Bühne frei. Nie in meinem Leben habe ich mich stärker überwinden müssen, etwas zu sagen. Ein auswendig gelernter Text, aus vorherigen Begegnungen mit Motz-Verkäufern zusammengeklaut: „Guten Tag meine Damen und Herren, entschuldigen Sie die Störung. Ich weiß, Sie haben es bestimmt heute schon einige Male gehört, aber ich verkaufe die Motz. Ich bin bedürftig und mit einer kleinen Spende oder dem Kauf der Motz helfen Sie mir weiter.“ So spreche ich in den gut gefüllten Wagen hinein, ohne jedoch wirklich einen Adressaten zu haben. Die Verkäufer der Obdachlosenzeitungen kommunizieren Privates mit Fremden in einem Raum, der für alle anderen eine Zone des Nicht-Kommunizierens zu sein scheint.
Obwohl ich nur schauspielere, schäme ich mich. In jedem Abteil begegnen mir nur betretene Blicke. Man versucht, mich wegzuschweigen. Ich habe mich in einen Menschen verwandelt, dessen Anwesenheit reines Unwohlsein hervorruft. Meine Zeitung kauft niemand und die rar gesäten Momente des Mitleids in Form von Kleingeld werden zur Wohltat für mich. Ich freue mich über kleine Spenden so, als sei ich wirklich von ihnen abhängig. Bereits im ersten Zug ernte ich sogar ein Lächeln von einer Frau mit Kinderwagen, sie gibt 30 Cent.
Die U12 ist wenig ertragreich, ich steige am Kottbusser Tor in die U8 um. Ein Phänomen tritt in allen Linien auf, in denen ich versuche, die Motz zu verkaufen: Wenn einer im Wagen etwas gibt, geben viele; wenn ich in der ersten Hälfte des Wagens nichts bekomme, steige ich auch mit leeren Händen aus. Existiert ein Wohltätigkeitsgruppendruck? Oder kann sich der Mensch erst zu einer Spende an einen Obdachlosen überwinden, wenn ihm vorgemacht wurde, dass es doch nicht so schwer ist? Vielleicht brauchen die Nachzügler die Gewissheit, dass eine Spende nicht als Gesprächsaufforderung missverstanden wird, dass nicht doch in irgendeiner Form auf meine im Raum schwebenden Fragen eingegangen werden muss? Kaufen wir uns frei mit 30 Cent?
Alexanderplatz. Seit einer Stunde starre ich auf den Cola-Becher, den ich heute morgen bei McDonald’s geklaut habe. Die paar Cent in dem Becher trügen, ich habe noch nichts eingenommen. Sie sollen einen Anreiz schaffen, etwas zulegen. Eine weiße Wand wird nicht beschmiert, bis sich der erste Schriftzug auf ihr findet. Ich sitze am Fuß einer Treppe, die von den S-Bahngleisen zu den U-Bahnlinien führt und zähle die Personen, die Minute für Minute an mir vorüberziehen. Und keiner sieht mich.
Ich erhebe mich, verstaue den Becher in den Tiefen meiner Jacke und fahre zum Brandenburger Tor. Die Momente, in denen ich nicht aktiv bettle, nehme ich als Befreiung war – zwar bin ich immer noch ungewaschen und schlecht angezogen, doch habe ich das Gefühl, eine durchsichtige Schranke zu passieren, die es mir erlaubt, für eine kurze Zeit wieder in der Masse unterzugehen. Der Moment, in dem ich mich dann wieder zum Betteln hinsetze, ist wie das erste Wort in jedem neuen Bahnwagon: mit der Last mitleidiger, urteilender und betretener Blicke beladen. Ich sitze zwischen den Säulen des Brandenburger Tors und frage mich, ob ein echter Bettler diese Last in dem Moment, in dem er seinen Becher vor sich hinstellt, je ablegt; ob sie leichter wird oder ihn immer weiter in die Knie zwingt. Binnen zwei Minuten werde ich von einem Sicherheitsmitarbeiter verjagt. Betteln sei hier nicht gestattet, sagt er mir freundlich.
U Heidelberger Platz. Studentenumschlagort. Ich bin hier, um der heranwachsenden Akademikerschaft auf den Zahn zu fühlen: Wie solidarisch zeigen sich die Studenten mit einem jugendlichen Bettler? Doch für Solidarität scheint auf dem Nachhauseweg keine Zeit mehr zu sein und so landen in den drei Stunden am Heidelberger Platz nur 40 Cent in meinem Becher. Das einzige Geld kommt von einem Mann, der mich fast liebevoll fragt: „Und? Warum musst du hier sein?“ Meine Antwort hört er dann doch nicht mehr, denn die U-Bahn kommt und der Mann eilt fort. Dann irgendwann, ich habe aufgehört die Bahnen zu zählen, steigt aus der U3 ein Pärchen mit Schäferhund aus. Sie, tiefe Furchen im Gesicht und auf ihn gestützt, ruft mir schon von Weitem zu: „Hey du! Penner! Wo ist hier’n Dealer!“ Der Penner: „Keine Ahnung, ich bin hier sonst nie.“ Sie wankt. Ein richtiges Gespräch endet.
Mit jeder Minute, die ich länger bettle, schaue ich den Menschen weniger ins Gesicht. Sie sehen mir nicht in die Augen, warum sollte ich ihnen in die Augen sehen? Menschen werden zu Fuß- und Beinpaaren, die an mir vorüberziehen – und ich beginne, sie hüftabwärts in Kategorien einzuteilen: Warum sollte ich mir bei dieser Horde Kinderbeine Hoffnungen machen? Schüler geben nie etwas. Das nächste Paar Schuhe sieht teuer aus. Zu teuer. Endlich bleiben ein paar Beine stehen und ein Koffer wird vor mir abgestellt. Noch bevor ich den Kopf heben kann, wird mir ein Zettel vors Gesicht gehalten. Es stehen Termine drauf. „Ich darf jetzt hier spielen!“, stellt der Mann fest. Es ist der Akkordeonspieler vom Heidelberger Platz. Er will mir meinen Platz streitig machen und hat allem Anschein nach die Behörden auf seiner Seite. Still ziehe ich von dannen.
Am Ende dieses Tages habe ich meine Ausgaben beinahe gedeckt, aber keine einzige Zeitung verkauft. Auf meiner letzten Tour erlebe ich dann doch noch einen Moment normalen zwischenmenschlichen Umgangs. Ich bin auf dem Nachhauseweg in der Ringbahn und auf meine Frage hin, ob jemand die Motz kaufen will, blickt ein Mädchen auf, sie ist vielleicht 16. Sie sieht mir direkt ins Gesicht und sagt ganz einfach: „Nein.“
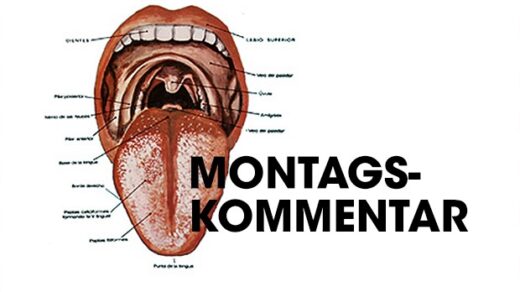



ein toller artikel, hat mir supergut gefallen! mehr davon!