Im Studium lernen angehende Mediziner*innen, wie sich Überbelastung am Arbeitsplatz vermeiden lässt. Wie ironisch, findet Judith Rieping, werden doch Medizinstudierende regelmäßig an ihre Grenzen getrieben.
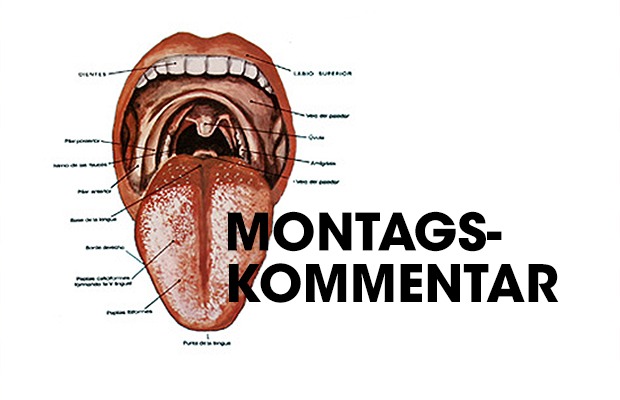
Eine junge Studentin sitzt in der medizinischen Fakultät über ihren Unterlagen zur Arbeitspsychologie. Sie versucht, sich schnell möglichst viel davon zu merken. Mit dem Finger fährt sie über die verschiedenen Kategorien eines Modells, das die Belastungen eines Arbeitsplatzes einschätzen sollen. Doch sie macht einen entscheidenden Fehler und wendet das Modell auf sich selbst an, das Ergebnis: „erhöhtes Risiko für psychische Überbeanspruchung“.
Das Modell vor dem sie sitzt ist das viel zitierte „Anforderungs-Kontroll-Modell“ des Soziologen Robert Karasek und setzt die Anforderungen einer Arbeit mit der jeweiligen Kontrolle über die Gestaltung dieser Arbeit in Beziehung. Besonders belastend ist demnach eine Arbeit mit hohen Anforderungen und gleichzeitig geringer Kontrolle.
Willkommen zurück in der Schule
Die Medizin ist klar als belastende Arbeit zu verorten, denn die Inhalte sind extrem umfangreich. Gleichzeitig ist das Studium trotz des reformierten Modellstudiengangs stark verschult: Anwesenheitspflichten in den meisten Kursen, ein vorgeschriebener „Lernziele“-Katalog, vorgefertigte Stundenpläne und ein aufwändiger bürokratischen Apparat, der die Anwesenheit dokumentiert und durch Kontrollen und Nachholtermine durchsetzt.
Die „erfolgreichsten“ Abiturient*innen mit den Einser-Schnitten werden somit betreut, als könnten sie sich Inhalte nicht selbstständig aneignen, als sei es zu viel erwartet, über die Relevanz von Lehrveranstaltungen selbst zu entscheiden. Dabei bedeutet diese Selbstständigkeit vor allem Kontrolle über die eigene Ausbildung. Nimmt man den Studierenden diese Kontrolle, riskiert man ihre „Überbeanspruchung“ am Arbeitsplatz. In den Pausen hört man dann Studierende leise über Reizdarmsyndrome und chronischen Schlafmangel flüstern. Ärzt*in werden, koste es, was es wolle!
Den Eindruck, dass hier etwas falsch läuft, bestätigen auch Studien. Eine Untersuchung an der Uni Leipzig zeigte eine signifikante Erhöhung in der Stressbelastung von Medizinstudentinnen im Vergleich zu der gleichaltrigen Normalbevölkerung. Außerdem weisen Medizinstudierende ein deutlich höheres Vorkommen von Depressionen, Angsterkrankungen und Suchtverhalten als Vergleichsgruppen auf.
Ohne Krisen, kein Examen
Es bleibt der Eindruck, das schwierigste am Studium sei die erfolgreiche Stressbewältigung. Zynische Stimmen könnten jetzt sagen, auch das könne als Qualifizierung dienen. Doch ist es wirklich im allgemeinen Interesse, Generationen von Ärzt*innen zu produzieren, die nur nach überstandenen Persönlichkeitskrisen das Examen überreicht bekommen? Wie sinnvoll ist eine Vorlesung zur Arbeitspsychologie, wenn die vermittelten Erkenntnisse bei der Organisation des Studiengangs ignoriert werden?
Mehr Wahlpflichtveranstaltungen, eine eigene Stundenplanung und weniger Anwesenheitspflichten könnten die Emanzipation der Studierenden zu selbständig lernenden Ärzt*innen fördern. Genau das, was in den lebenslangen Fortbildungen auch von ihnen erwartet wird.



