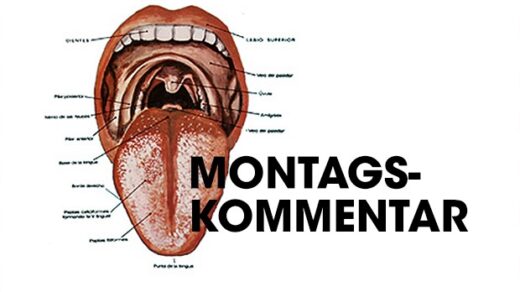Anlässlich der vorlesungsfreien Zeit widmet sich Annika Grosser dem Phänomen des pathologischen Aufschiebens – natürlich anstatt ihre Hausarbeit zu schreiben.
Wir schreiben den 23. August 2019. Seit Beginn der vorlesungsfreien Zeit und meiner letzten Klausur sind nun 38 Tage vergangen. Die erste Hälfte der Semesterferien ist glanzlos verstrichen, obwohl sie ursprünglich der Start einer glorreichen, produktiven Phase hatte werden sollen. Denn mir stellt sich ein unverwechselbares Problem in den Weg: Ich bin unmotiviert. „Macht ja nichts“, flüstert die süße Stimme der Prokrastination in mein Ohr, „morgen ist auch noch ein Tag.“ Abgabetermin meiner Hausarbeit: in 37 Tagen.
Studentensyndrom. Aufschieberitis. Prokrastination. Welchen Terminus man auch verwendet, das Krankheitsbild präsentiert sich immer gleich: extremes Aufschieben dringlichster Aufgaben. Symptomatisch sind sowohl Demotivation als auch ein schlechtes Gewissen. Risiken und Nebenwirkungen sind mannigfaltig und reichen vom unproduktiven Wochenende bis hin zur Abschlussarbeit, die einfach nicht fertig werden will.
Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung
Dem Internet sei Dank kann heutzutage jede*r Psycholog*in spielen. So führt mich meine Recherche zum Selbsttest für pathologisches Aufschieben der Prokrastinationsambulanz an der Universität Münster, der mich für die nächste halbe Stunde beschäftigen sollte.
In unangenehmen Situationen tendieren Menschen, wie die meisten Lebewesen, zwecks Vermeidung negativer Gefühle zu Fluchtverhalten. Soweit logisch. Da die Konsequenzen, beispielsweise die Bewertung einer Hausarbeit, erst später getragen werden müssen, ist der Mensch dazu im Stande, verschiedenste ausgefeilte Verhaltensmuster des Aufschiebens zu entwickeln. Online-Tests machen, beispielsweise. Diese Muster führen zwar kurzfristig zu einem Gefühl des Wohlbefindens, resultieren aber auf lange Sicht in Stress, Leistungsabfall und Schuldgefühlen (vgl. Höcker / Engberding, 2017). In meinem Fall liegt das Problem offensichtlich im Aspekt der „Aktiven Suche nach Ablenkung“.
Hoffnungsloser Fall?
Weiter im Test. „Bewerten Sie: Um nicht mit einer wichtigen Arbeit anfangen zu müssen, erledige ich sogar Dinge, die mir sonst lästig wären.“ Absolut. Zwar steht von meiner Hausarbeit bisher nur die Überschrift, dafür ist meine Wand frisch gestrichen, meine Fenster sind geputzt, und all die kleinen To-Dos abgearbeitet, die es sich seit Wochen auf meiner Liste gemütlich gemacht haben. „Wie viele Stunden hätten Sie in der letzten Woche insgesamt arbeiten müssen, um Ihre Ziele zu erreichen?“ Tja, vermutlich so einige.
Die gute Nachricht? Laut Internetdiagnose liegen die Wurzeln meiner Prokrastination weder in einer Aufmerksamkeitsstörung noch in einer Depression. Ob das Maß an krankhaftem Aufschieben wohl stattdessen mit der Studienfachwahl zu tun hat?
H1: Geisteswissenschaftler*innen prokrastinieren regelmäßiger und stärker als Naturwissenschaftler*innen.
H0: Zwischen Studienfachwahl und Ausmaß der Prokrastination besteht kein signifikanter Zusammenhang.
Meine Erfahrungen deuten darauf hin, dass Studierende im Allgemeinen gute Aufschieber*innen sind. In Anbetracht meiner bisher non-existenten geisteswissenschaftlichen Hausarbeit kann jedoch vorerst keine der Hypothesen verworfen werden.
Da ich leider nicht über die nötigen Ressourcen für ein solch ambitioniertes, kontroverses Forschungsprojekt verfüge, prokrastiniere ich die Hypothesenprüfung erstmal mit etwas anderem lästigen. Meiner Hausarbeit, zum Beispiel.