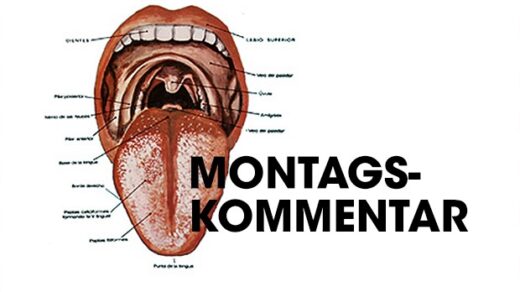Wenn das Seminar zur Nachtschicht wird oder das Auslandssemester vor dem Laptop im Wohnheimzimmer endet. Eindrücke aus Kolumbien, Ecuador und Frankreich. Von Philipp Schaffranek und Anabel Rother Godoy
Eigentlich wollte Juan seine Eltern in den Semesterferien nur für ein paar Wochen besuchen. „Dank” Corona wurden aus Wochen Monate und Juan steckt in Cali fest. Eine große Umstellung für den 23-jährigen Politikstudenten. Seit 5 Jahren lebt er in Berlin. Deutschland ist mittlerweile sein Zuhause.

Schon einige Male hat er versucht, mit den Flügen vom Auswärtigen Amt zurückzufliegen. Ohne Erfolg. Deutsche Staatsbürger*innen haben Vorrang, danach sind erstmal die anderen Europäer*innen an der Reihe. Nächste Woche kann auch er endlich mitfliegen, für stolze 720 Dollar.
Kolumbien ist natürlich auch von Corona betroffen. Die Lockdown-Maßnahmen sind dort noch heftiger als in Deutschland. Menschen über 60 dürfen überhaupt nicht aus dem Haus. Kinder durften das bis vor Kurzem auch nicht. Der Rest darf einmal in der Woche den Einkauf tätigen. An welchem Tag man an der Reihe ist, bestimmt die Endziffer der Sozialversicherungsnummer.
Langsam werden die Regelungen gelockert, weil die Wirtschaft enorm leidet. Juans Vater ist Arzt in einem Krankenhaus und hat mit unzureichenden Ressourcen zu kämpfen. Von der Regierung bekommen die Ärzte dort kaum Unterstützung.
Sein Studium muss Juan trotz allem fortsetzen. Von Seiten der FU stößt er auf wenig Unterstützung. Einige seiner Kurse sind Online-Präsenzveranstaltungen, für die er zum Teil schon um 5 Uhr aufstehen muss. Dass einige Studierende mit einer Zeitverschiebung konfrontiert sind, hat offenbar bei der Planung des Kreativ-Semesters keine Rolle gespielt. Juan wandte sich mit seinem Problem an den Fachbereich und die Studienberatung, stieß dort aber auf taube Ohren. Am Ende konnte er mit den Dozierenden Sonderregelungen abmachen. Das klappte gut. Trotzdem ist er erleichtert, bald wieder in Berlin zu sein. Die Reaktion der Uni hat ihn enttäuscht: „Die FU brüstet sich mit Internationalität und Diversität. In der Realität scheint das die Uni kaum zu interessieren.”
Nachtschicht dank Corona
Zwei Jahre lang hatte Isabel ihre Eltern und Geschwister nicht gesehen. Entsprechend aufgeregt war sie, in den Semesterferien endlich nach Ecuador zu reisen. Nun steckt sie dort fest, wahrscheinlich noch bis Juli.

In Lateinamerika ist Ecuador eins der am meisten vom Coronavirus betroffenen Länder. Und die Situation ist weiterhin ernst. Isabel erklärt: „Politiker kaufen Masken und Geräte zu überteuerten Preisen von gefälschten Firmen. Wenn das ans Licht kommt, tritt der entsprechende Politiker zurück und entschuldigt sich. Die Krankenhäuser stehen weiterhin ohne Ausstattung da und Millionen von Dollar sind verschwunden”.
In Cuenca, ihrer Heimatstadt, gehen täglich Menschen auf die Straßen, um gegen die Korruption und fehlende medizinische Ausstattung zu protestieren. Das Haus darf man nur zwischen 5 Uhr morgens und 14 Uhr Nachmittags verlassen, danach herrscht Ausgangssperre. Wer in einen Supermarkt will, wird zuerst von Kopf bis Fuß mit Desinfektionsmittel eingesprüht.
Die Möglichkeit mit dem Auswärtigen Amt zurückzufliegen gibt es in Ecuador nicht. Isabel muss warten, bis die Flughäfen wieder öffnen. Ihr Biologie-Studium macht die 22-jährige also von Cuenca aus weiter. Seminare finden von 2 bis 5 Uhr morgens statt. Erst danach kann sie schlafen gehen. Für jeden Kurs muss sie am gleichen Tag Hausaufgaben hochladen. Wegen der Zeitverschiebung ist das nicht machbar, also muss sie alles vorarbeiten.
Schon zweimal hat Isabel sich an den Fachbereich gewendet und um Hilfe gebeten. Eine Antwort kam bis jetzt noch nicht. In einem Seminar braucht sie ein Buch, das sie in Ecuador nicht kaufen konnte. Zum Glück hat die Professorin ihr alle wichtigen Seiten gescannt und zugeschickt.
Wieder bei ihren Eltern zu leben ist ungewohnt, sie kann es kaum erwarten zurück in Berlin zu sein und endlich wieder früh einschlafen zu können.
Erasmus im Lockdown-Feeling
Felix macht seit letztem September ein Erasmus-Jahr an der Universität Straßburg. „Wir dachten, ab März können wir endlich wieder mehr draußen machen“, sagt der Politikstudent. „Und dann ging der März los und alle sind abgereist.“ Auf seiner Etage im Wohnheim sind von 35 Studierenden nur fünf geblieben. Er wollte nicht weg aus Straßburg. Auch wegen seiner Freundin, die er dort kennengelernt hat. Als Griechin hätte sie nur nach Griechenland gekonnt. Er als Deutscher nur nach Deutschland.

Seit Mitte März darf der 20-Jährige das Wohnheim laut Gesetz nur zum Einkaufen verlassen. Und auch nur im Umkreis von einem Kilometer. Besuche in der deutschen Stadt Kehl, nur drei Stationen mit der S-Bahn entfernt, sind nicht mehr möglich. Seine Joggingstrecke führte über eine der vielen Brücken, die Straßburg und Kehl verbinden. Jetzt sperren fünf Polizist*innen die Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich. Aktuell werden die Regeln wieder etwas gelockert.
„Ich hatte Sorge, dass es mir zu langweilig wird“, sagt Felix. Sieben Quadratmeter – so groß ist sein Wohnheimzimmer. Alle Gemeinschaftsräume wurden mit dem Lockdown geschlossen. Auch das Klavierzimmer, in dem er gerne nur für sich gespielt hätte. Anfangs hat er viel gelesen, Filme geguckt und Musik gehört. Später hat er sich auf zwei mündlichen Prüfungen vorbereitet, die online stattfanden. Jetzt muss er noch zwei Essays schreiben. Sein Semester kann Felix erfolgreich abschließen. Auch, weil das Sommersemester schon im Februar los ging, als das Coronavirus noch weit weg zu sein schien und so ein großer Teil des Semesters noch normal ablief.
Ende Mai ist sein Austausch vorbei. Bis dahin will er bleiben. Wie er wieder zurück nach Deutschland kommt, weiß er noch nicht genau. Wahrscheinlich wird sein Vater ihn abholen, da unklar ist, wie die Züge trotz der gelockerten Grenzkontrollen fahren. Mit seinen Freund*innen aus der Erasmus-Zeit hält er weiter Kontakt. Irgendwann soll es dann auch nochmal ein richtiges Treffen geben. Im März waren die meisten Hals über Kopf abgereist. Zeit für eine richtige Abschiedsfeier gab es da nicht.