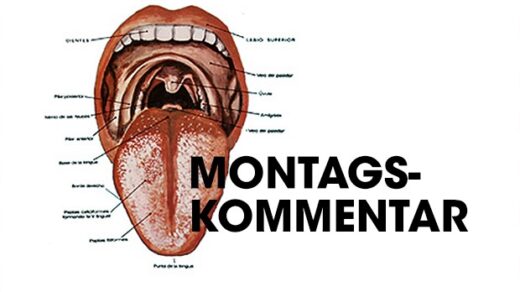Martin Scorsese kehrt mit dem filmischen Portrait eines kriminellen Brokers zurück zu vertrauten Gefilden. Ist der Hype um „The Wolf of Wall Street“ berechtigt? Von Christoph Spiegel

Vier Kulturgrößen: Bob Marley, Johann Wolfgang von Goethe, Woody Allen und William Shakespeare. Illustration: Luise Schricker
In unserer Serie „Kulturreif“ besprechen wir das Neueste aus Literatur, Film, Theater und Musik. Teil 6: Martin Scorsese’s „The Wolf of Wall Street“.
Es ist eine amerikanische Verbrecherkarriere: von den ersten jugendlichen Berührungen mit der Kriminalität über den Aufstieg im organisierten Verbrechen bis hin zur unvermeidlichen Niederlage gegen den Staat und seine Behörden. Mit „Goodfellas“ (1990) schuf Martin Scorsese aus dem Leben des amerikanisch-sizilianischen Mafioso Henry Hill einen Klassiker. Nun, 24 Jahre später, versucht er es noch einmal: „The Wolf of Wall Street“ ist die Verfilmung der gleichnamigen Memoiren des kriminellen Brokers Jordan Belfort. Zumindest geographisch betrachtet ist Scorsese dabei nicht sehr weit gekommen: Er verschiebt seinen Blick auf Wall Street und dubiose Brokerunternehmen in Long Island, nur ein paar Kilometer entfernt vom Milieu der New Yorker Italo-Mafia.
Keine tiefen Einblicke
Ein leichtes Gefühl von Déjà vu ist daher zu erwarten, wenn Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle als Jordan Belfort per Voiceover – wie einst auch Ray Liotta in GoodFellas – durch die Handlung führt. Mit Wertpapierbetrügereien und Geldwäsche schuf sich Belfort während der Neunzigerjahre ein Vermögen in dreistelliger Millionenhöhe, samt 50-Meter-Yacht, gigantischem Anwesen und blondem Ex-Model als Ehefrau. „The name of the game: moving the money from the client’s pocket to your pocket“, gibt ihm sein Boss Mark Hanna dabei am ersten Arbeitstag mit auf den Weg. Tiefere Einblicke in die kriminellen Winkel der Finanzwelt gewährt einem der Film allerdings gezielt nicht.
Stattdessen beschäftigt sich „The Wolf of Wall Street“ fast ausschließlich mit Belforts exzessivem Lebensstil und setzt neben seinem unvorstellbaren Drogenkonsum auch sein Sexualleben ausführlich in Szene. Unabhängig von großen Studios finanziert zeigt der Film dabei für amerikanische Maßstäbe wenig Zurückhaltung: Die von Belfort begründete Firma Stratton Oakmont hat in einigen Szenen mehr Ähnlichkeiten mit einem Bordell als mit einem Brokerunternehmen. Diese obsessive Beschäftigung mit dem Oberflächlichen und Krassen ist essentieller Teil des Films.
Die große Bühne
Die Parallelen zu „GoodFellas“ sind trotz Ähnlichkeiten in der Handlung denn auch begrenzt: Während Ray Liottas Charakter in „Goodfellas“ kritisch auf sein Leben zurückblickt, bekommt der Selbstdarsteller Jordan Belfort nach seinem Buch nur noch eine größere Bühne. Schon nach dem Eingangsmonolog ist klar: Hier sehen wir Jordan Belforts Version der Realität; eine idealisierte, verklärte Variante der Geschehnisse, in der auch Leonardo DiCaprio niemals Jordan Belfort, den Menschen spielt, sondern ausschließlich Jordan Belfort, den Charakter.
Das mag zunächst wie eine erfrischende Alternative zum morallastigen Hollywood-Regelwerk klingen. Doch „The Wolf of Wall Street“ verkommt letztendlich zu einer einzigen Reizüberflutung, da sich Scorsese wissentlich mehr auf den Effekt einzelner Szenen verlässt, anstatt sich um ein kohärentes Gesamtwerk zu kümmern. Drei Stunden, ein paar Dutzend nackte Körper und unzählige Linien Koks später ist man einfach nur ausgelaugt – und ein wenig ratlos. Während es Scorsese sonst gelingt, seine moralisch fragwürdigen Hauptcharaktere zu vermenschlichen, bleibt hier jede Identifikationsmöglichkeit auf der Strecke. So wird die unglaubliche Menge an Talent und Erfahrung, die dem Projekt zur Verfügung standen, letztlich durch die Banalität des Materials und die Einfältigkeit des Portraitierten ausgebremst.