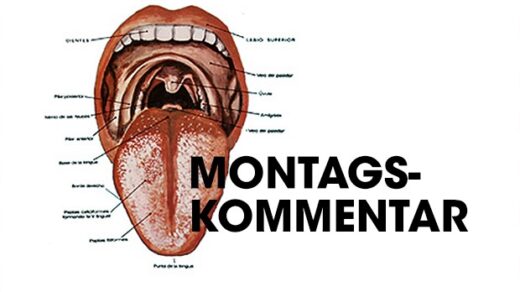Universitäten sind skurrile Orte: elitär und verwinkelt. Angehende Studierende sind erst einmal von diesem Schauspiel geschockt, entfernen sich aber selbst schnell vom Rest der Welt. Über den Prozess der Assimilation. Von Karolin Tockhorn

Unbeholfen irre ich durch die Flure der Rost- und Silberlaube, auf der Suche nach Raum JK 27/106. Mir schwirren tausend Gedanken durch den Kopf und ich weiß nicht so recht, worauf ich mich mit der Immatrikulation an der FU eigentlich eingelassen habe. Bald merke ich, dass das Finden der Räume nicht das einzig Fremde an der Uni ist. Während der ersten Woche in meiner neuen Rolle als Studentin wurde mir bewusst, dass an der Uni irgendwie alles ganz anders läuft. Ich fühlte mich wie ein Fremdkörper.
Als erstes fiel mir auf, dass alle versuchten, besonders intellektuell zu klingen. Während der Diskussionsrunden in den Seminaren schwangen Studierende große Reden und nahmen Wörter in den Mund, die mir in meinem Leben noch nie begegnet waren. In welchem Kontext hätte ich auch von »Subalternität« oder »Eudaimonie« hören sollen? Ich habe das Gefühl, dass es unter meinen Kommilitonen einen Wettbewerb gab: Wer kann seinen Beitrag verbal am stärksten ausschmücken und dabei so unverständlich wie möglich klingen. Es glich eher einem Schauspiel als einem Seminar. Der Raum schien auf einmal als Bühne zu fungieren, auf der alle versuchten, ihr Wissen oder eher Halbwissen zur Schau zu stellen. Schnell kristallisierte sich heraus, wer die führenden Rollen in diesem Bühnenspiel übernehmen würden. Es waren von Sitzung zu Sitzung immer dieselben, die ihre Texte gut auswendig gelernt hatten. Nicht selten gab es zwei oder mehrere Opponenten, die die Spannungskurve stets nach oben trieben. Es dauerte nicht lang, bis die Neuankömmlinge ihre passende Rolle gefunden hatten und fortan bei jeder Vorstellung dieselbe Maske aufsetzten. In den meisten Fällen gab ich mich mit einer Statistenrolle zufrieden. Für mich klappte das Lernen auch, ohne dabei im Rampenlicht zu stehen.
In meiner Schulzeit wäre ich allerdings sogar dafür zu einer Antagonistin erklärt worden. Damals galt es stets als uncool, sich für die Inhalte zu begeistern, die die Lehrer verzweifelt zu vermitteln versuchten. Cool waren immer diejenigen, die sich nicht interessierten und rebellierten. Gespräche über gesellschaftliche und politische Themen verließen selten das heimische Wohnzimmer. Ich kann mich nur an wenige Momente während meiner Schulzeit erinnern, in denen ich Diskussionen dieser Art mit meinen Freunden geführt hätte. Auch wenn es anfangs an der Uni für mich schwierig war, gewöhnte ich mich an den akademischen Rhythmus – und entfernte mich dafür noch mehr von meiner alten Welt. Inzwischen ist es normal, dass mein Mittagessen in der Mensa von Debatten über den Syrien-Konflikt, Präsidentschaftswahlen in Frankreich oder Fragen über das Wesen des Bösen begleitet wird… Anders sieht das aus, wenn ich mich in mein ehemaliges Umfeld zurück wage. Mit meinen Freunden von daheim, die nicht studieren, ist es oft schwer auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Wir stoßen auf gegenseitiges Unverständnis. Ich erinnere mich gut, wie eine Freundin völlig entgeistert über mein Abonnement des »Spiegel« war und mir dann erzählte, sie selbst lese nur die »Glamour«.
In solchen Situationen stempeln wir in unserer akademischen Arroganz andere Leute oft als simpel gestrickt ab. Dabei fühlte ich mich vor einem Jahr doch noch selbst wie ein Fremdkörper auf dem Campus. Deshalb rufe ich mir heute oft in Erinnerung, dass es da draußen noch eine andere Welt gibt. Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht alle Menschen sich um eine Rolle in unserem – vielleicht manchmal skurrilen – Theaterstück beworben haben.