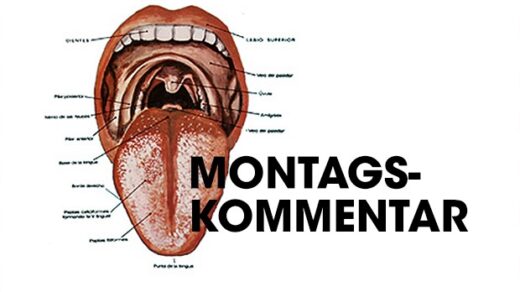Um sich für Furios ihrer dezenten Sozialphobie zu stellen, hat Rabea Westarp einen Tag in der Pflege verbracht. Ein Bericht über Urinbeutel, Katheter und einen kurzen Halt im Paradies.

Ein Ausflug in ungewohntes Terrain. Foto: flickr.com
Ich würde mich als offenen und kommunikativen Menschen bezeichnen. Es gibt jedoch Situationen, in denen es mir furchtbar schwer fällt, die richtigen Worte und den richtigen Ton zu finden – zum Beispiel im Umgang mit hilfsbedürftigen, alten oder schwachen Menschen. Sobald ich in eine Situation komme, in der Einfühlungsvermögen oder schlicht nette, aufmunternde Worte von mir verlangt werden, habe ich massive Berührungsängste und Hemmungen. Was also könnte mich mehr herausfordern, als ein Tag in einem sozialen Beruf?
Meine Mutter arbeitet als Altenpflegerin in einem mobilen Pflegedienst. Im Schichtdienst fährt sie von Patient*in zu Patient*in und versorgt diese Zuhause. Als ich in den Semesterferien auf Heimatbesuch bin und mir die FURIOS-Aufgabe im Nacken sitzt, entscheide ich: Diese Woche komme ich mit.
Um 05:30 Uhr bereue ich diese Entscheidung zum ersten Mal. Eine Stunde später beginnt der Frühdienst, und als ich neben Mama im Auto sitze und unterwegs mein Müsli hinunterschlinge, schwindet meine Motivation. Bei der ersten Patientin betrete ich im Windschatten meiner Mutter die Wohnung. Verlegen stelle ich mich vor und will erklären, weshalb ich heute dabei bin, aber die freundliche, demente Dame scheint mit den Gedanken woanders zu sein.
Hinter jeder Tür eine neue Herausforderung
An diesem Vormittag erwartet mich hinter jeder der zehn Wohnungstüren, die wir auf unseren Patientenbesuchen passieren, etwas anderes. Die meisten der älteren Herrschaften empfangen mich sehr freundlich in ihrer Wohnung, obwohl die Situation überaus intim ist. Mal sind sie verwirrt, scheinen kaum Notiz von mir zu nehmen, dann wiederum bieten sie mir herzlich etwas zu essen an und stellen mir Fragen.
Der Umgang mit Kathetern verstört mich auch noch beim x-ten Mal und beim Waschen stehe ich eher unnütz im Weg herum. Aber während meine Mutter ihre Patient*innen rasiert, ihnen Thrombose-Strümpfe anzieht, sie umlegt und ihnen ihre Medikamente verabreicht, beginne ich zaghaft Gespräche mit ihnen zu führen, meistens über ihre Haustiere oder die Hitzewelle der vergangenen Wochen.
Konfrontation mit der Vergänglichkeit
Einer Patientin waren diese Themen jedoch nicht tiefgründig genug. Meine Mutter holt gerade frische Kleidung aus dem Nebenraum, da fängt die alte Dame an zu philosophieren: „Ich möchte schlafen, einfach schlafen. Aber ich will nicht schon wieder sterben.“ „Schon wieder? Aber sterben geht doch nur einmal“, erwidere ich stupide und wünsche mir sehnlichst meine Mutter wieder ins Zimmer. „Doch“, beharrt die Frau, „ich war schon mal im Himmel.“ Unruhig trete ich von einem Fuß auf den anderen. „Oh. Und wie war es da?“ erkundige ich mich freundlich. „Schön, doch, schön“, murmelt die Patientin.
Eine weitere Antwort bleibt mir erspart, meine Mutter kehrt in den Raum zurück und übernimmt das Gespräch. Die Dame erörtert nun nüchtern die Unvollkommenheit des Menschen, meine Mutter hört ihr zu und scheint an den richtigen Stellen das Richtige zu sagen.
Ich bin beeindruckt von ihr, wie routiniert und absolut respektvoll sie mit ihren Patient*innen umgeht. Ausgelaufene Katheter und Urinbeutel scheinen bei ihr, anders als bei mir, keinerlei Fluchtreflexe oder Ekelgefühle auszulösen. Sicherlich eine Frage der Gewöhnung – vielleicht könnte ich mich beim nächsten Heimatbesuch einfach wieder mit ins Auto schwingen. Viel wahrscheinlicher bleibt es jedoch bei diesem einmaligen Experiment.