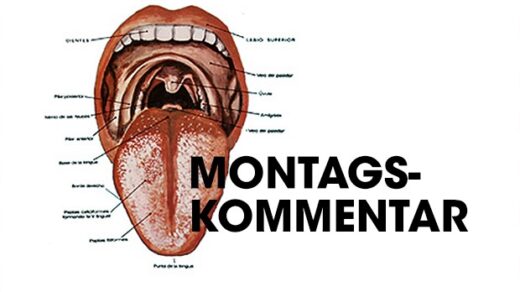Wenn wir träumen, können wir die absurdesten Dinge erleben. Manchmal fühlt sich das Geträumte sogar beinahe real an. Warum ist das so? Wie funktionieren Träume überhaupt? Von Annika Grosser.
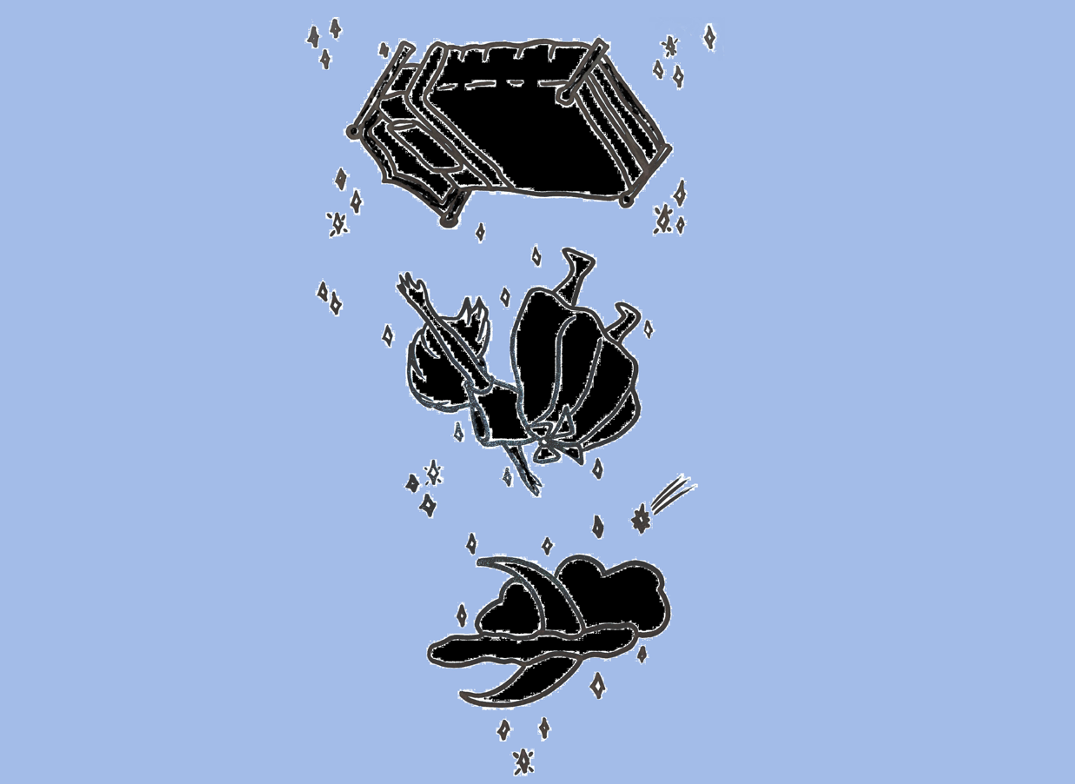
Träume sind schon seltsam. Stell dir mal vor: Du rollst auf deinem Schreibtischstuhl durch einen Park im Wedding, plötzlich bricht ein Stuhlbein ab, du fällst und landest im Schwimmbecken eines politischen Parteitags. Die Diskussion dort verpasst du leider, da du von Menschenfänger*innen vor der Kirche angequatscht wirst, die du aber stehen lässt, um deine entführten Freunde von einer südamerikanischen Insel vor Kopenhagen zu retten. Verwirrt wachst du auf. Wer hat sich das denn bitte ausgedacht?
Das Mysterium Traum fasziniert die Menschheit seit Jahrhunderten. In den nächtlichen Hirngespinsten suchten die großen Kulturen der Antike und verschiedene Religionen Rat für Kriegsentscheidungen oder vermuteten sogar eine Brücke zwischen dem Diesseits und der Unterwelt. In Europa ist die Praxis der „Traumdeuterey” hauptsächlich durch Traumbücher belegt, die durch zufälliges Aufschlagen einer Seite Zukunftsvorhersagen erlauben sollten. Die Kirche verdammte diese Methode zwar als Zauberei, doch noch heute finden solche Bücher zusammen mit Tarotkarten Verwendung.
Als Begründer einer völlig neuartigen Traumtheorie gilt Sigmund Freud mit seinem revolutionären Werk „Die Traumdeutung“. Basierend auf seinen Annahmen der Psychoanalyse sind Träume Äußerungen unterdrückter Wünsche und Triebe, die im Konflikt zwischen zwei Instanzen der menschlichen Psyche stehen – dem Es, der „dunkle, unzugängliche Teil unserer Persönlichkeit“, und dem moralgeleiteten Über-Ich. „Wir nähern uns dem Es mit Vergleichen, nennen es ein Chaos, einen Kessel voller brodelnder Erregungen“, schreibt Freud. Traumanalyse sei die einzige Möglichkeit, das unterbewusste Es zu verstehen und die eigenen verwerflichen Gelüste zu dechiffrieren, die das Über-Ich sonst erfolgreich unterdrückt. Ganz im Einklang mit Freuds Forschung handelt es sich hierbei vor allem um Sexträume.
Heute ist Freuds Traumanalyse stark umstritten. Die aktuelle Forschung ist sich relativ sicher, dass Träumen vordergründig dem emotionalen Ausmisten dient. Das Erlebte wird verarbeitet, das Wichtige verinnerlicht und der Rest entsorgt – und das eben häufig in Form von bizarren Gedankenergüssen. Dazu gehört auch, dass wir uns im Schlaf mit ungelösten Problemen beschäftigen. So entschlüsselte James Watson die Doppelhelixstruktur unserer DNA, nachdem er des nachts von einer Wendeltreppe träumte. Ein knappes Jahrzehnt später erhielten er und sein Kollege für die Entdeckung den Nobelpreis für Medizin. Wie aber kann es sein, dass manche Menschen jeden Morgen die verrücktesten Traumgeschichten zu erzählen haben und andere sich an absolut nichts erinnern?
„Ein Traum hat kaum einen Anfang oder ein Ende, ist keine Aufgabe, die nachts ansteht und einmal erfolgreich abgearbeitet von der ToDo-Liste verschwindet“, erklärt Steffen Richter, Schlafmediziner an der Charité Berlin. „Es gibt keine Nächte mit einem Traum oder Nächte ohne Traum, den Unterschied macht nur die Erinnerung an das Träumen nach dem Aufwachen.“ Ob wir uns am nächsten Morgen an unseren Traum erinnern, hängt davon ab, in welcher Schlafphase wir aufwachen. Die aktive Phase unseres Schlafs nennt sich REM: Rapid-Eye-Movement-Schlaf. Zwar träumen wir in jeder Phase, unsere Träume im REM-Schlaf sind aber am lebhaftesten und gleichen am ehesten einer zusammenhängenden Geschichte. Mit nur 25 Prozent unseres Schlafs macht die REM-Phase rund 85 Prozent unserer Träume aus, für gewöhnlich spät nachts bis früh morgens. Unser Körper fällt währenddessen in eine Art Paralyse, die uns davor schützen soll, unsere Träume körperlich auszuleben. Deshalb schlagen wir im REM-Schlaf nicht um uns oder fallen aus dem Bett, wenn wir im Traum vor jemandem weglaufen oder uns verteidigen. Es kommt allerdings vor, dass der Effekt noch anhält, wenn wir aus der REM-Phase erwachen. Manche Menschen können sich dann vorübergehend nicht bewegen oder sprechen.
Besonders bei lebhaften Albträumen neigen wir zur körperlichen Reaktion und wälzen uns gerne im Bett umher. Die Bezeichnung „Albtraum“ rührt von bösen kleinen Elfen her, den sogenannten Alben aus der germanischen Mythologie. Schlechte Träume sind zwar unangenehm, doch laut Steffen Richter nicht einfach abzutun: „Wenn wir dem Träumen schon einen Zweck unterstellen, sollten wir auch bereit sein zu akzeptieren, dass die Arbeit, die dort verrichtet wird, nicht nur unserer Unterhaltung dient, sondern auch einmal unangenehm werden kann. Aus evolutionärer Sicht ergibt es Sinn, dass zuallererst die Probleme gelöst werden, die für uns vital bedrohlich sein könnten.“ Wiederkehrende Albtraumstörungen haben ihren Ursprung meist im Wachzustand. So können sich Unfälle, Kriegserfahrungen oder andere traumatische Erlebnisse, die der Mensch nur schwer bewältigen kann, tief im Unterbewusstsein festsetzen. Im Schlaf durchlebt die Psyche das Trauma erneut in abgewandelter Form und versucht, es zu verarbeiten. Doch es gibt Techniken, die bei der Überwindung helfen können. Dafür sollen sich Betroffene für den jeweiligen Albtraum ein Happy End ausdenken und sich die neue Geschichte im Anschluss täglich vorstellen. So erlangen wir im Wachzustand Kontrolle über unsere Träume.Selbiges funktioniert auch umgekehrt: beim luziden Träumen, einem Stadium zwischen REM- und Wachzustand. Die schlafende Person ist sich dabei ihres Traumzustands bewusst und kann ihn daher manipulieren. Wenn wir schlafen, ruht sich für gewöhnlich auch der Präfrontale Cortex aus, der in Zusammenhang mit Handlungsplanung und Hirnaktivität steht. Erwacht dieser Teil unseres Gehirns jedoch, durchschauen wir Unstimmigkeiten unseres Traums – etwa die fehlende Logik hinter unseren Fähigkeit zu fliegen. Dieses partielle Erwachen kann man lernen. So können wir selbst die Regie übernehmen und über den weiteren Verlauf unseres Traums bestimmen. Mit dem luziden Träumen eröffnet sich zudem die Möglichkeit, unsere Leistung durch aktives Traumtraining zu optimieren. Abläufe von Choreografien, Läufen oder anderen Sportarten lernen wir dadurch buchstäblich im Schlaf. Forscher*innen warnen allerdings: Im Schlaf regeneriert sich der Körper. Auch der Geist braucht seine Zeit, die Informationsflut zu verarbeiten, die täglich auf uns einprasselt. Steffen Richter sagt, es sei „eine eigenartige Neigung des Menschen, jedes Erleben, jeden Körperzustand, jeden Gedanken kontrollieren und unangenehme Inhalte sofort ausblenden zu wollen.“ Ob man seinen kostbaren Schlaf der Selbstoptimierung opfern möchte, will also gut überlegt sein. Sind die schönsten Träume nicht eh jene, die wir zum ersten Mal „erleben“?