Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen werden auch ohne Corona-Krise schon genug geknechtet, meint Antonia Böker. Das zu ändern, hat der Staat jetzt verkorkst.
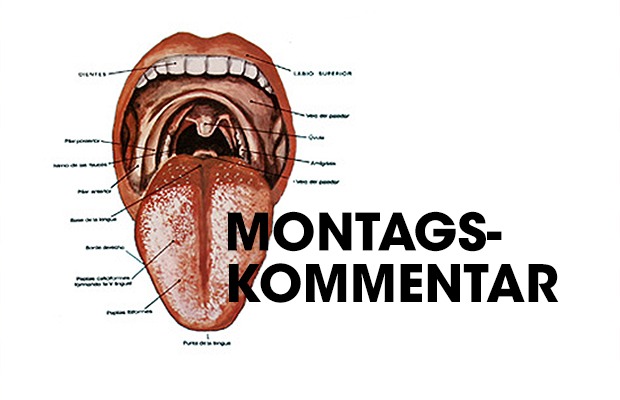
Die Arbeit in der Wissenschaft ist prekär. Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (WiMis) ackern mehr, als sie sollten, für weniger, als sie wollten, in Jobs, die im Bestfall einmal auf zwei Jahre befristet sind. Das ist dann schon das ganz, ganz große Los. Die Befristung regelt dabei das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG). Dieses hat der Bund gerade angepasst, um der schwierigen Lage vieler WiMis durch die Corona-Krise gerecht zu werden. Er hat das Ziel meilenweit verfehlt.
Eigentlich soll das WissZeitVG helfen, indem es dem wissenschaftlichen Nachwuchs die Chance auf eine Zukunft eröffnet, in der er sich nicht von einer Befristung zur nächsten hangelt. In der Praxis gibt es einen stringenten Zeitrahmen vor: Das Gesetz greift in den sogenannten „Qualifikationsphasen“, jeweils sechs Jahre vor und sowie ab der Promotion. Damit deckt das Gesetz die Zeit ab, in der der Wissenschaftsnachwuchs den Lebenslauf aufpoliert, Drittmittel eintreibt und möglichst Vieles und möglichst Gutes publiziert. Kurz: Die Zeit, in der WiMis die Gründe sammeln, warum zur Hölle eine Hochschule sie einstellen sollte. Danach dürfen sie nicht mehr befristet werden.
Hilfe für den Allzweck-Affen WiMi
Und darin liegt jetzt auch die Krux: Mit einer Pandemie hat niemand gerechnet. Jetzt ist sie aber da und erschwert den Forschungsalltag massiv – insbesondere für die Wissenschaftler*innen, für die das WissZeitVG greift. Immerhin sind es, – das ist kein Geheimnis – vor allem sie, die die Hochschullehre schultern. Gegenüber der FURIOS hatte es eine Promovierende einmal so ausgedrückt: Profs überschütteten WiMis mit Verwaltungsaufgaben, dazu kämen Fördergeld- und Forschungsanträge. Für Seminare bleibe kaum Zeit. Und dann ist da ja noch die eigene Forschung. Dank Corona müssen jetzt plötzlich neue Formate erarbeitet, Seminarpläne umgeworfen und angepasst, Podcasts aufgenommen und hochgeladen werden.
Die Verlängerungsmöglichkeit soll nun Abhilfe schaffen, indem die Maximalbefristung um bis zu sechs Monate erweitert werden kann. Die Idee: Die Zeit, die dem Nachwuchs durch massive Einschränkungen für die eigene Qualifikation verloren geht, kann nachgeholt werden. Am Ende geht es dann im Wettbewerb um den Verbleib im Wissenschaftsbetrieb eben doch wieder darum, worum es eben gehen sollte: Die eigene Leistung. Ende gut, alles gut – oder? Eben nicht.
Unis urteilen über Frauenschicksale
Problem Nummer eins: Es handelt sich hierbei um eine reine Kann-Regelung und nicht etwa eine „Kann-WiMi-machen-wenn-gewünscht“-Regelung. Nein – es obliegt allein den Unis, zu entscheiden, ob sie die Option wahrnehmen. Die Zukunft der angehenden Wissenschaftler*innen vollkommen in die Hände der Personalabteilungen an Hochschulen zu legen, scheint dann doch irgendwie suboptimal. Gerade, wenn man sich die Misserfolgsgeschichte deutscher Unis in Sachen prekäre Beschäftigung anguckt. Das findet übrigens auch die GEW: Ein Rechtsanspruch auf diesen Zeit- und damit Nachteilsausgleich wäre das Mindeste. Das Mindeste, weil nicht alle vor den gleichen Herausforderungen stehen.
Problem Nummer zwei: Es ist was faul im Staate. Mit einer Petition versuchen verschiedener Wissenschaftler*innen der LMU Halle-Wittenberg und RWTH Aachen, darauf aufmerksam zu machen, denn bereits vorhandene Ungleichheiten potenzierten sich momentan. „Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter*innen mit Care-Verpflichtungen stehen vor einer kurzfristigen Umstrukturierung ihrer Pflege- und Arbeitszeiten, die sich langfristig in ihre Karriere auswirken wird“, heißt es. Ein Großteil dieser Sorgearbeit erledigen Frauen. Dass für sie die Belastungen von Pflegetätigkeiten und Wissenschaftsbetrieb auch ohne Pandemie schon oft untragbar sind, ist bestenfalls ein offenes Geheimnis. Nicht umsonst gibt es erschreckend wenige Professorinnen. Die Corona-Krise wirkt sich nicht nur stärker auf Arbeitskapazitäten von Frauen aus, sie werden vermutlich auch länger brauchen, um die Defizite auszugleichen. Kinder haben sie nämlich auch dann noch, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Das könnte man in der Neuregelung berücksichtigen. Natürlich nur, wenn man es ernst meint.
Bis dahin: Danke für wortwörtlich nichts!



