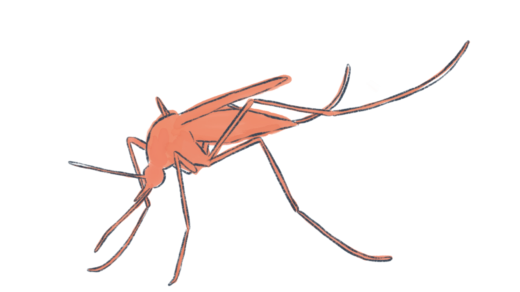Wer wütend ist, wird im politischen Diskurs nicht mehr ernst genommen. Zurecht? Warum Wut im Aktivismus ganz nützlich sein kann. Ein Kommentar von Anaïs Agudo Berbel.

U3 Richtung Krumme Lanke. Die Anzeige der Stationen flackert auf. Direkt daneben berichtet die Welt auf dem kleinen Bildschirm schon wieder über die sogenannten Klimakleber. Ach mensch, Axel Springer! Wie könnt ihr Klimaschutzaktivist*innen, so abwertend darstellen? Warum schreibt ihr denn genau wie der frustrierte, alte weiße Mann, über den die woke Jugend Witze macht? Und wieso denkt ihr, dass die junge Generation bei allem übertreibe, dass sie zu emotional sei und keine vernünftige Diskussion führen könne? Diese Wut ist genau das, was Aktivismus braucht.
Wut sorgt dafür, dass wir uns wehren wollen. Sie als wertvolle Emotion anzuerkennen, ist sehr wichtig. Denn Wut hat immer einen Grund: Indem wir wütend werden, erkennen wir Ungerechtigkeit, unsere eigenen Grenzen und bemerken, wenn diese überschritten werden. Wut mobilisiert. Wut gibt Mut und Kraft, um im Protest Grenzen zu überschreiten. Deshalb spielt sie für den Aktivismus eine wichtige Rolle. Gerade in politischen Gruppen schweißt gemeinsame Wut gegen systemische Missstände zusammen und kann auf bestimmte Ziele kanalisiert werden. Wer aus seiner Wut heraus auf eine Demonstration geht, ist laut, ist beharrlich und dadurch sichtbar.
Dass studentische Gruppen Hörsäle besetzen, so wie zuletzt End Fossil zusammen mit weiteren aktivistischen Gruppen an der Humboldt Universität zu Berlin, passiert also aus Wut über die aktuellen Missstände. In der Mehrheitsgesellschaft sind von Wut getriebene Proteste aber nicht gern gesehen. Stattdessen soll lieber an die Vernunft appelliert, der Frieden bewahrt und der Kompromiss bereitgehalten werden. So weit, so wütend.
Şeyda Kurt, Journalist*in und Autor*in, bezeichnet im kürzlich erschienenen Buch Hass Deutschland als ein Land der „Friede, Freude, Eierkuchen“-Mentalität. Kurt bringt auf den Punkt, warum Wut vor allem im Aktivismus notwendig ist: Das Bedürfnis nach Einigkeit im Diskurs ist illusorisch und paradox. Wenn unser eingetrichtertes Harmoniebedürfnis stets im Vordergrund steht, verhindert genau das einen zielführenden Diskurs.
Umso wichtiger ist es, abzuwägen, wie Wut in Gesprächen strategisch sinnvoll einzusetzen ist. Wenn Argumente und Motive nicht mehr inhaltlich sachlich formuliert werden, weil das Gespräch durch Wut zu sehr von einer Argumentationslinie abweicht, hören viele Menschen nicht mehr zu. Wut ist dann hilfreich, wenn sie Argumente und Thesen emotional untermauert und diese der Gegenseite auf persönlicherer Ebene kommuniziert werden.
Aber auch die Seite, der Wut entgegengebracht wird, reagiert auf Proteste oft mit Wut. Wer mit dem Auto auf die A100 fahren will und dann im Stau landet, da die Straße blockiert wird, regt sich natürlich darüber auf. Diese Wut richtet sich in erster Linie jedoch nicht gegen die aktivistischen Gruppen, sondern auf die Störung des Alltags. Ab dem Zeitpunkt konzentriert sich die Wut der Gegenseite nicht mehr auf die angeprangerten Missstände, sondern nur auf die Störung an sich. Dabei ist ein zielführender Diskurs meist nicht mehr möglich. Hinzu kommt, dass aktivistische Gruppen innerhalb der öffentlichen Berichterstattung oft als Grund des Ärgernisses betitelt werden und wenig auf das eigentliche Ärgerniss, die angeprangerten Missstände, und die Dringlichkeit ihrer Ziele eingegangen wird.
Von daher ist es wichtig zu differenzieren, worauf sich die Wut bezieht: Die Wut, die Aktivist*innen vereint und sich gegen den Missstand richtet, richtet sich gegen etwas anderes als die Wut, die das Gegenlager vereint. Wut senkt unsere Hemmschwelle für Grenzüberschreitungen und drängt Aktivist*innen auf die Straße. Sie senkt unser Bedürfnis nach Einigkeit und sorgt dafür, dass wir im Diskurs hartnäckig bleiben. Sie verhindert aber auch Kompromisse und Sachlichkeit, macht uns emotionsgeladen und kann zu Lagerbildung führen. Wir brauchen beides: Wut und Diskurs. Das widerspricht sich nicht zwangsläufig – auch wenn es oft so dargestellt wird.