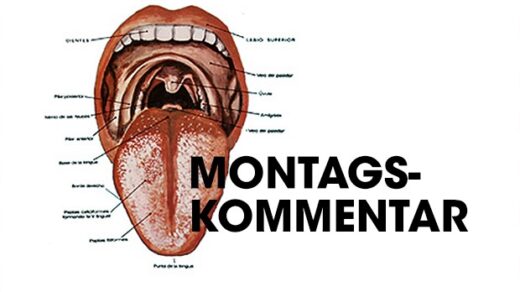Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz soll nur Wenige an die Spitze der Forschung befördern. Was hinter diesem langen Wort steckt und warum dabei so viele auf der Strecke bleiben. Eine Glosse von Lena Stein und Mariya Martiyenko.

Es ist immer wieder dasselbe: Wir hocken im Seminar und stellen fest, dass wir uns ausschließlich mit Folien aus den 2000ern beschäftigen. Zum x-ten Mal bekommen wir die Lehrinhalte durch Referate von Kommiliton*innen beigebracht, die den Stoff genauso wenig verstanden haben wie wir. Da liegt es nahe, den wissenschaftlichen Mitarbeitenden, also den Lehrenden, die Schuld fürs Einnicken im Seminar zu geben. Der wahre Übeltäter ist jedoch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG).
Auch die Dozierenden kuscheln sich nachts in eine Decke an liegengebliebenen To-Do’s, den Tränen nahe. Aus der vertraglich festgelegten 20-Stunden-Woche wird schnell eine Vollzeitstelle mit halbem Gehalt. Neben Forschung und Lehre muss dann auch noch irgendwie eine Doktorarbeit geschrieben werden. Wenn dann die zehnte Anfrage eines*r verzweifelten Studierenden im E-Mail Postfach landet, der*die im fünften Semester danach fragt, wie genau man nochmal eine Hausarbeit schreibt, stehen Dozierende vor der Entscheidung: Mail beantworten oder Doktorarbeit schreiben? Lehre konzipieren oder forschen? Hausarbeiten korrigieren oder die nächste Publikation vorbereiten?
Nicht selten führt der Zeitdruck dazu, dass Mails monatelang liegen bleiben und eine gute Lehre aus den Urgesteinen der PowerPoints und halb-richtigen Referaten besteht, um bloß selbst keinen Redeanteil im Seminar vorbereiten zu müssen. Und im schlimmsten Fall wirst du ohne Vertragsverlängerung im eiskalten Regen stehen gelassen. Da kommt’s schnell zur Existenzkrise, die ohne unterstützende Eltern nicht abgefangen werden kann. Klar betrifft es nicht Justus mit seiner geerbten Eigentumswohnung in Wannsee, sondern Chantal als Erstakademikerin aus Marzahn. Und wir Studierenden stellen uns in dieser Situation die allerwichtigste Frage: Wer korrigiert jetzt meine Hausarbeit?
Während man dann den Berg an Aufgaben ignoriert und am Handy daddelt, kann man seit Herbst 2020 unter #ichbinHanna eigene negative Erfahrungen in der Wissenschaft twittern. Hanna, das ist eine Figur aus einem Erklärvideo des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), die befristet in der Wissenschaft tätig ist. Hanna findet es wundervoll, ständig in neue Jobs einzutauchen und flexibel zu sein. Wer findet es auch nicht schön, sich für seinen*ihren Traumjob totzuackern und nicht zu wissen, ob man diesen in zwei Jahren überhaupt noch ausführen darf? Das Video, das die befristeten Verträge beschönigt, ist nach dem Hashtag auf mysteriösem Wege verschwunden.
Eigentlich sollte das im Jahr 2007 verabschiedete WissZeitVG den Nachwuchswissenschaftler*innen neue Möglichkeiten eröffnen. Alteingesessene Postdocs sollten vom Thron gestoßen werden, um Platz für neue Forschende zu schaffen – eine Art Rotation in der Wissenschaft. Damit sollte Deutschland als Wissenschaftsstandort wieder sexy werden.
Das WissZeitVG verlangt, dass wissenschaftliche Mitarbeitende im akademischen Bereich bis zu sechs Jahre tätig sein dürfen. Beschert das Schicksal den jungen Wissenschaftler*innen das Glück der Elternschaft, haben sie zwei Jahre lang Gelegenheit, ihr Kind weniger zu vernachlässigen. Bleiben sie kinderlos, vernachlässigen sie sich immerhin nur selbst – dafür zwei goldene Jahre kürzer. Nach dem Doktortitel haben Postdocs noch maximal sechs Jahre Zeit, um sich für eine Professur zu qualifizieren – die einzige unbefristete Stelle, das Licht am Ende des Tunnels. In dieser Zeit kommt es zu Kettenbefristungen: Eine befristete Teilzeitstelle folgt der nächsten.
Die sechs Jahre nach der Promotion sind geprägt von Publikationsdruck, Zeitmangel, fehlender Planungssicherheit, Standortwechsel, Zukunftsangst, Konkurrenzdenken und Ellenbogen-Gerangel. Denn Mehr ist gleich Mehr und Quantität geht vor Qualität. Lieber jedes Wochenende eine neue Publikation, als die Wissenschaft mit guten Studien vorantreiben. Wenn man dann nach 17 Jahren, in denen man die Sommer mehr in der Bibliothek als am See verbracht hat, nicht durch den Flaschenhals der Professur kommt, wird man entlassen. Die akademische Karriere ist beendet. Um weiterhin in der Forschung zu arbeiten, bleibt nur noch der Hürdenlauf von Projekt zu Projekt. Auch die Steuergelder, die in die Ausbildung dieser Menschen geflossen sind, die dann aber ausrangiert wurden, waren vergebens.
Und viel Spaß auf dem Arbeitsmarkt mit jüngstens Ende 30, der zwar wissenschaftliche Arbeit nicht als nennenswerte Berufserfahrung außerhalb der Academia anerkennt, Menschen mit Doktortitel aber zugleich als überqualifiziert wahrnimmt. Und wenn man schon jemanden ohne große Berufserfahrung einstellt, dann lieber die günstigeren Master-Absolvent*innen.
Im Sinne des Innovationsdrucks und der angeblichen Bestenauslese würden auf dem Weg zur Professur die sauren Kirschen aussortiert werden: Klingt ganz nach FDP-Mindset, die Partei also, die gerade die aktuelle Bildungsministerin stellt. Es drängt sich die Frage auf, warum nur die Postdocs den Wissenschaftsbetrieb verstopfen, die Profs hingegen auf ihren Dauerstellen sitzen bleiben dürfen.
Im März 2023 kam dann die Lösung aller Probleme: eine neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz-Reform. Versuch das dreimal schnell hintereinander zu sagen. Das BMBF hat seinen Vorschlag auf ganzen zwei Seiten vorgelegt: Statt sechs Jahren sollen Postdocs nur noch drei Jahre Zeit bis zur Professur haben. Da scheint jemand wohl das Abgabedatum verpeilt zu haben und musste am Abend vorher noch schnell etwas runterschreiben. Einen medialen Aufschrei, viele wütende Hannas und 51 Stunden später wurde der Entwurf zurückgezogen. Das war wohl ein Schuss in den Ofen – das hat auch Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) auf die harte Tour feststellen müssen.
Dabei gibt es auch andere Ideen zur Verbesserung der prekären Arbeitsverhältnisse: mehr Dauerstellen unter und neben der Professur sowie feste Zielvereinbarungen in der Postdoc-Phase, die den angehenden Profs bei Erfüllung einen unbefristeten Vertrag verschaffen sollen. Doch dazu braucht es die Bereitschaft der Politik, mehr Geld in die Wissenschaft zu investieren. Denn letztendlich bleibt es dabei: Wir sind Hanna – oder zumindest kennen wir eine. Deshalb müssen wir wütend sein – und zwar nicht erst dann, wenn wir ein Seminar zum zweiten Mal besuchen müssen, weil unsere Hausarbeit nicht mehr bewertet wird.