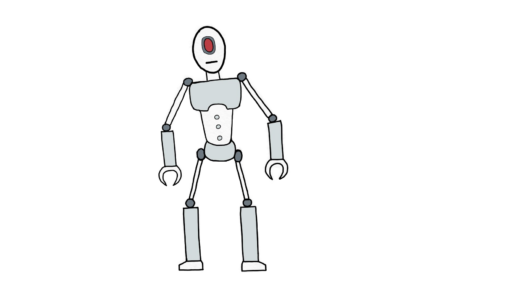Ausbrechen aus einem nine-to-five Arbeitsalltag durch Arbeiten am Strand in fremden Ländern. Klingt traumhaft? Doch hinter den rosaroten Wolken des digitalen Nomadentum verbergen sich unerwartete Herausforderungen. Marika berichtet Line Grathwol von Freude und Tränen.
In Istanbul wohnt Marika bei Neta und deren Familie. Morgens bringt sie Netas fünfjährigen Sohn Amrei in die Schule. Danach arbeitet sie. Meistens setzt sie sich dafür in ein Café – an jedem Wochentag in ein anderes. Nach der Arbeit holt Marika Amrei wieder ab und geht mit ihm zum Spielen in einen Park. Abends hat sie dann Zeit für ihre Freund*innen und um Istanbul zu erkunden. Denn Marika kommt eigentlich aus Pretoria in Südafrika. 2022 lebte sie ein Jahr lang als digitale Nomadin in Kapstadt, Namibia, Simbabwe, Botswana, Jordanien und schließlich in der Türkei.
Marika wollte immer schon reisen. Aber erst als ihr ein Remote-Job mit der Möglichkeit zu reisen angeboten wurde, konkretisierte sie ihren Plan. »Alle Grenzen sind weggefallen«, erzählt sie, um das Gefühl zu beschreiben, das sie hatte, als sie die Jobzusage bekam. »Ich hatte die Möglichkeit, mir komplett selbst auszusuchen, was ich erleben möchte.«
Immer mehr Menschen machen es wie Marika und entscheiden sich für ein Leben als digitale Nomad*innen. Sie arbeiten ortsunabhängig und reisen dabei um die Welt. Die 2023 von MBC Partners veröffentlichte Studie bildet den Trend ab: 2023 leben 17,3 Millionen Menschen als digitale Nomad*innen. 2019 waren es noch 10 Millionen weniger. Das entspricht einem Anstieg um 131 Prozent in den letzten vier Jahren. Dr. Fabiola Mancinelli ist solchen quantitativen Studien gegenüber eher kritisch eingestellt. Sie lehrt an der Universität Barcelona und forscht als Anthropologin zu digitalen Nomad*innen. Sie sagt: »Digitale Nomad*innen, das ist ein reißerischer Begriff, der viel Aufmerksamkeit generiert und die Schlagzeilen füllt. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass das Phänomen größer erscheint als es ist.« Sie habe allerdings durchaus den Eindruck, dass nicht nur in den USA, sondern auch in Europa die Anzahl digitaler Nomad*innen steige.
Vom Leben auf Reise
Hinter dem Entschluss, auf der Reise zu arbeiten, stehe der Wunsch, sich von einem festen Arbeitsplatz und Arbeitsalltag zu befreien, erklärt Mancinelli. Anders als bei Menschen in etablierten Anstellungsverhältnissen seien Unbeständigkeit, Minimalismus und auch Risikobereitschaft essenzielle Themen im Leben digitaler Nomad*innen. Materiellen Besitz anzuhäufen, Stabilität und Komfort würden dagegen als weniger wichtig wahrgenommen.
Marika erzählt von dieser Freiheit: »Ich konnte meinen Tagesablauf, die Orte, an denen ich arbeiten und die Art, wie ich leben will, frei wählen.« An manchen Tagen arbeitete sie in Cafés, an anderen in ihrer jeweiligen Unterkunft oder auch im Park. »Es war toll, so viele Menschen kennenzulernen und so viel Neues zu erleben.« Marika hat ihren etablierten Alltag in Südafrika gegen ein Leben eingetauscht, in dem sie sich alle paar Monate an neue Umgebungen gewöhnen musste. Ein Leben, in dem sie sich ihr Dach über dem Kopf erarbeitete und aus dem Koffer lebte. Das ist ein Teil der Freiheit, die sie beschreibt – bedeutet aber auch Meta-Arbeit.
Meta-Arbeit nennt Mancinelli die Arbeit, die zu der bezahlten Arbeit hinzukommt und die gebraucht wird, um den Lebensstil als digitale Nomad*in aufrechtzuerhalten. Darunter fällt etwa die Planung von Unterkünften oder die Orientierung in einem fremden Land. Marika hat die Meta-Arbeit selbst kennengelernt: Für einen kostenlosen Schlafplatz und Verpflegung half sie in Jordanien in einem Hostel aus. Neben ihrem Remote-Job und eigenen Erkundungstouren in der Felsenstadt Petra erledigte sie zusätzlich noch Aufgaben für das Hostel. Da sei nicht viel Zeit für sie selbst geblieben. »Aber das war nicht schlimm«, meint sie. Denn dadurch hätte sie viele Menschen kennenlernen können. Sich Pausen zu nehmen, sei allerdings schwierig gewesen. »Ich wollte nichts verpassen. Und das kann ganz schön anstrengend sein.«
Die digitale Arbeitsweise der digitalen Nomad*innen und ihr flexibler Lebensstil sorgen für neue Herausforderungen. Denn die Möglichkeit, jederzeit arbeiten zu können und dasselbe Gerät für die Arbeit und Freizeit zu nutzen, kann schnell zur Überarbeitung führen. Die ersehnte Autonomie kann auch einschränkend sein. Der Anthropologe Dave Cook identifiziert das große Ziel der digitalen Nomad*innen als den Wunsch, das Verhältnis von Arbeit und Freizeit neu zu definieren, deren scheinbare Gegensätzlichkeit aufzuheben. Doch dabei unterschätzten die meisten, wie viel Disziplin dies erfordere. Denn beim Arbeiten am Strand wird das Meer zu einer großen Versuchung. Die Methoden, um einer solchen Versuchung entgegenzuwirken, zielen oft darauf ab, Arbeit und Freizeit wieder zu trennen. Cook nennt das ›the freedom trap‹ – die Freiheitsfalle.
Marika betont immer wieder, dass ihre Zeit als digitale Nomadin alle Herausforderungen wert gewesen sei. Sie strahlt und gestikuliert, wenn sie Geschichten aus diesem Jahr erzählt. Dieses Bild zeichnet auch Instagram. Unter dem Hashtag #digitalnomad stößt man auf Bilder von lächelnden Menschen, meist am Meer, im Flugzeug oder vor diversen Sehenswürdigkeiten. Wenn Mancinelli das stereotypische Bild von digitalen Nomad*innen malt, ist es »ein Mann, mitten in seiner Karriere, Millennial, also 25 bis 38 Jahre alt, aus einem Industrieland, single und weiß.« Dieser arbeite meist in einem technischen Beruf mit überdurchschnittlichem Einkommen und hat einen Pass mit guten Visa-Konditionen. Marika als weiße Frau aus Südafrika entspricht zwar nicht dem Idealtypus, hat aber viele stereotype Erfahrungen gemacht.
Das System hinter dem Traum
Die meisten digitale Nomad*innen besitzen jene Privilegien des Stereotypen, fügt Mancinelli hinzu. Davon ausgehend würden sie es durch ihren Lebensstil schaffen, ihre Privilegien zu vergrößern. Denn wer sich im teuren New York kaum eine Wohnung leisten kann, zieht in Bangkok ins beste Viertel. Ihr Lebensstil sei ein »opportunistisches Anpassen an die Umstände, die durch die neoliberale Ideologie entstanden sind«, sagt Mancinelli.
Sie stellt fest: Digitale Nomad*innen brechen also eigentlich nicht aus dem System aus, sondern navigieren in ihm zu ihren Vorteilen. Dabei verstärkten sie teilweise die Gentrifizierung. Tourist*innen ziehen nur vorübergehend in Ferienwohnungen ein – und die Lissaboner*innen müssten wegen zu hoher Mieten ausziehen. Oft sei die politische Situation in den Zielländern für digitale Nomad*innen nicht relevant, führt Mancinelli aus. Sie nehmen dort nicht an Wahlen teil, haben eine sichere Krankenversicherung und ihre Kinder durchlaufen nicht das lokale Bildungssystem. »Digitale Nomad*innen sind entpolitisierte Produkte einer individualisierten Gesellschaft«, sagt Mancinelli.
Wenn Marika von der großen Freiheit in ihrem Leben als digitale Nomadin erzählt, weiß sie, was sie im Gegenzug aufgegeben hat. Das Leben in einer festen Gemeinschaft beispielsweise. Ein Sicherheitsnetz aus Menschen, die einen auffangen. Dafür gibt es zahlreiche Apps zum Vernetzen und auch Menschen, die Festivals, Zusammenkünfte und Workshops organisieren. Über eine dieser Apps hat Marika auch die weitgereiste Neta kennengelernt. Ihr Tausch: Unterkunft gegen Kinderbetreuung. Trotzdem erzählt Marika, dass sie nach einem Jahr Herumreisen vermehrt ihr Zuhause vermisst habe. Als sie in ihrem Alltag in Istanbul einmal an Zuhause erinnert wurde, rief sie weinend ihre Mutter an und änderte ihr Vorhaben. Anstatt wie geplant nach Georgien weiter zu reisen, flog sie zurück nach Hause. Jetzt lebt sie wieder in Südafrika, liebäugelt aber damit, in der Zukunft erneut eine Zeit lang als digitale Nomadin zu leben. Sie erinnert sich gerne an die Zeit zurück.