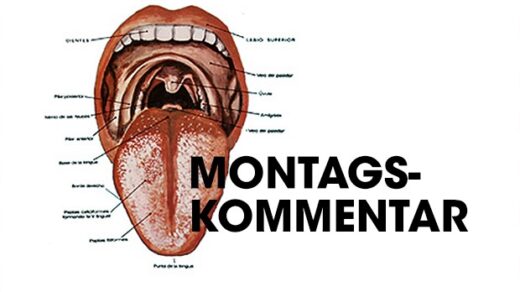Frauen sind heute in der Wissenschaft akzeptiert. Gleiche Aufstiegschancen wie Männer haben sie jedoch immer noch nicht. Lily Martin und Josta van Bockxmeer suchen nach der unsichtbaren Grenze.
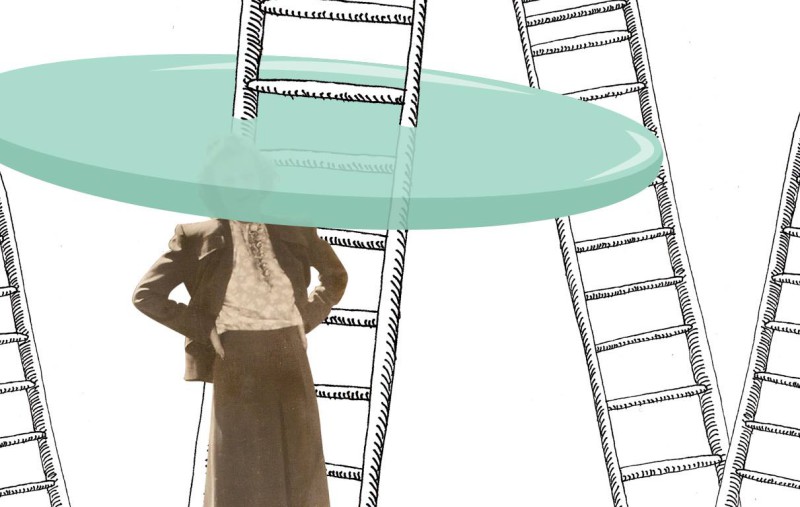
Der große Vorlesungssaal im Langenbeck-Virchow-Haus der Charité ist bis auf wenige Besucher leer. Doch die Wissenschaftlerinnen auf der Bühne scheint das nicht zu stören: Lebhaft diskutieren sie miteinander Karrierewege von Frauen in Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Ihr Fazit: Diskriminierung von Frauen in der Wissenschaft, das gibt es nicht mehr. „Wir haben eine Sonderstellung, die ein Vorteil ist“, sagt Caroline Szymanski, Promovendin in den Neurowissenschaften. Katharina Trettenbach, Studentin der Biochemie im zweiten Semester, pflichtet ihr bei: „In meiner Generation spielt Diskriminierung keine Rolle. Wir wollen Wissenschaftler werden, wir wollen Probleme lösen. Wer das macht – Männer oder Frauen – ist egal.“ Klaus Müllen, Vorsitzender der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte und einziger männlicher Sprecher, schließt die Diskussion: „Vielleicht machen wir uns über manche Dinge zu viele Sorgen.“ Das fehlende Interesse an der Veranstaltung scheint seine Worte zu bestätigen.
Es hat sich viel getan für Frauen in der Wissenschaft: Bis ins 20. Jahrhundert wurden Leistungen von Wissenschaftlerinnen unter dem Namen ihrer männlichen Kollegen veröffentlicht. Heute ist das anders. Der „Otto-Hahn-Bau“ der FU zum Beispiel wurde 2010 in „Hahn-Meitner-Bau“ umbenannt. Die Universität würdigte damit den bahnbrechenden Beitrag der Experimentalphysikerin Lise Meitner zur Erforschung der Radioaktivität.
Auch die Statistiken sehen vielversprechend aus: Die Zahl der Studienanfängerinnen in Deutschland liegt laut Statistischem Bundesamt bei 49,5 Prozent. Unter den Absolvierenden befinden sich sogar mehr Frauen als Männer, weil Frauen seltener ihr Studium abbrechen. Auch die Zahl der weiblichen Promovierenden ist in den letzten Jahren massiv gestiegen, mit 45,4 Prozent sind Frauen und Männer fast gleichauf. Hat der feministische Kampf um Veränderung also Früchte getragen? Macht man sich tatsächlich zu viele Gedanken über ein Thema, das eigentlich ad acta gelegt werden könnte?
Mechthild Koreuber kann über solche Fragen nur lachen. Sie ist zentrale Frauenbeauftragte der FU und sagt: „Heute ist Diskriminierung lediglich weniger sichtbar als vor zwanzig Jahren.“ Wenn sie über Frauen in der Wissenschaft spricht, fällt häufig der Ausdruck „gläserne Decke“. Das ist die unsichtbare Barriere, an die Frauen in der Wissenschaft immer wieder stoßen, vor allem, je höher sie auf der Karriereleiter steigen. Auch das belegen die Fakten. Obwohl fast die Hälfte aller Promovierenden Frauen sind, sind es unter den Habilitierenden nur 27 Prozent. Bei den Professuren schließlich sieht es mit einem Frauenanteil von 20,4 Prozent noch schlechter aus. Viele Frauen empfänden ihre Entscheidung gegen eine wissenschaftliche Karriere als selbstbestimmt, beschreibt Koreuber ihre Erfahrungen. „Wenn sie sich dann aber doch für eine Karriere im Wissenschaftsbetrieb entscheiden, dann habe ich sie hier. Völlig vor den Kopf gestoßen, weil irgendetwas komisch läuft.“
„Komisch“ wird es dann, wenn den Frauen gesellschaftliche Vorurteile im Weg stehen. Diese existieren fort, auch wenn Frauen und Männer formell gleichgestellt sind. An der FU etwa scheint sich auf den ersten Blick einiges gebessert zu haben: Die Kurzzeitbetreuung des Familienbüros beispielsweise ermöglicht es Eltern, wichtige Besprechungen oder Präsentationen wahrzu- nehmen, wenn die eigene Kinderbetreuung mal kurzfristig ausfällt. Kinder sollen kein Wettbewerbsnachteil mehr sein. An den Vorurteilen, dass die Betreuung des Nachwuchses prinzipiell Frauensache sei, dass Frauen gar durch ihre Gebärfähigkeit nicht zu hohen Positionen in der Wissenschaft taugen würden, ändert sich dadurch jedoch nichts. „Ob Männer für ihre Kinder Betreuung brauchen oder nicht, wird erst gar nicht diskutiert. Es existiert noch immer die Vorstellung, dass Frauen mit Kindern nicht das Gleiche leisten können wie Männer“, bemängelt Koreuber. Solche individuellen Vorstellungen und Vorurteile sind schwer erkennbar und formen die „gläserne Decke“. Die Barriere ist in den Köpfen.
Sandra Janßen hat in ihrer Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU selbst erlebt, dass es Frauen in der Wissenschaft schwerer haben als Männer. „Vor 25 Jahren konnten Frauen an der Universität nur funktionieren, wenn sie sich zu Männern machten: Kurzhaarschnitt, Hosenanzug, flache Absätze“, erzählt sie. Mit Frauen wie Barbara Vinken habe sich dieses Rollenbild verändert. Die bekannte Münchner Literaturwissenschaftlerin trägt seit mehr als 15 Jahren stets Netzstrümpfe zur Arbeit. „Sie und ich gehören zu den Generationen, die diese Betonung der eigenen Weiblichkeit gebraucht haben“, sagt Janßen. „Mir war es immer wichtig, lange Haare und Absätze zu tragen.“
Doch nur weil Wissenschaftlerinnen heute tragen können, was sie wollen, sind ihre Aufstiegschancen nicht unbedingt besser. „Männer halten sich für feministisch, wenn sie junge, attraktive Frauen fördern“, sagt Janßen. Mit zunehmendem Alter oder schwindender Attraktivität würden die Ambitionen der Frauen immer weniger ernst genommen. Gehe es dann darum, Positionen zu besetzen, die denen der Männer äquivalent sind, lasse jeglicher Förderungswille nach. Frauen, die dennoch Machtpositionen beanspruchen, gelten als „anstrengend“ oder „hysterisch“. „Eine Freundin von mir hat einmal gesagt: Als Frau in der Wissenschaft ist man entweder Zicke oder graue Maus“, erzählt die erfolgreiche Forscherin.
FU-Frauenbeauftragte Koreuber will, dass sich das ändert. Sie und ihr Team hinterfragen die vermeintliche Gleichberechtigung der Geschlechter in allen universitären Angelegenheiten; sie erstellen Leitfäden, um zum Beispiel Berufungsverfahren transparenter und resistenter gegen tradierte Geschlechtervorstellungen zu gestalten. „Alles mit dem Ziel, einen Kulturwandel zu erzeugen“, sagt Koreuber.
Probleme, die früher offensichtlich waren, sind heute unsichtbar geworden. Wie wenig sich die Geschlechterverhältnisse tatsächlich geändert haben, wird bei genauerem Hinsehen deutlich. Die Mission von Frauenbeauftragen wie Koreuber ist also noch lange nicht vorbei: „Auf eine gewisse Art und Weise sind wir Detektivinnen: Wir haben eine gläserne Decke, an der wir bohren, um sie sichtbar zu machen – und aufzulösen.“