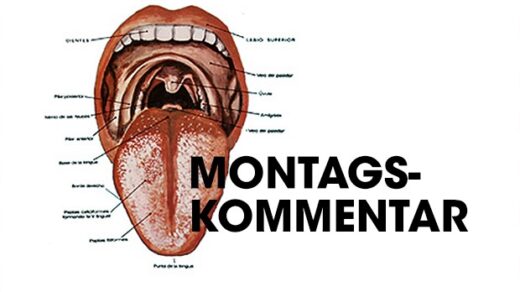Ein Paradoxon: Ausgangsbeschränkungen sollten Bürger*innen weltweit vor dem Coronavirus schützen, brachten aber viele Frauen in Lebensgefahr. Häusliche Gewalt und Feminizide haben in Krisenzeiten zugenommen. Von Julia Blaß, Johanna Jürgens und Laura Kübler.

„In einem Extremfall ist es häufig so, dass sich Phänomene, die schon immer da waren, wie unter einem Brennglas ganz deutlich zeigen”, erklärt Heike Pantelmann im Gespräch mit FURIOS. Genau so verhalte es sich auch mit sexualiserter und häuslicher Gewalt. Übergriffe seitens des Partner*s oder der Partner*in anzuzeigen, sei jedoch für viele immer noch mit Scham behaftet, weswegen Expert*innen von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Pantelmann ist die Geschäftsführerin des Margherita-von-Brentano-Zentrums für Geschlechterforschung an der FU. Gemeinsam mit ihren Kolleg*innen hat sie die Online-Diskussionsreihe „Transnational Feminist Dialogues in Times of Corona Crisis” organisiert, die sich unter anderem mit geschlechtsbasierter Gewalt aus internationaler Perspektive auseinandergesetzt hat.
Unter dem Veranstaltungstitel „Gender-Based Violence under Lockdown” zeichnen vier Forscher*innen aus dem Bereich der Gender Studies ein länderübergreifendes Bild zur Situation von Frauen im Lockdown. So erklärt Aleida Luján Pinelo, dass in der europäischen Mehrheitsgesellschaft viele Vorurteile zur Tötung von Frauen vorherrschten: Feminizide gäbe es in europäischen Ländern doch gar nicht, und wenn doch, dann nur innerhalb migrantischer Communities. Auch Pantelmann weist darauf hin, dass keine soziale Gruppe vor häuslicher Gewalt und Feminiziden gefeit ist: „Häusliche und sexualisierte Gewalt zieht sich durch alle Schichten. Es trifft alle.” Das zeige auch ihr Projekt zu sexualisierter Gewalt an Hochschulen.
Besonders gefährdet seien außerdem Minderheiten, wie Ailynn Torres Santana in der Online-Diskussion betont: Dazu zählt sie die LGBTIQ*-Community und von Rassismus betroffene Frauen, aber auch Sexarbeiter*innen, die sich in der Pandemie notgedrungen eigenständig um Aufträge kümmern müssen.
Corona-Pandemie verschärft bereits bestehende Probleme
Klar ist: Auch hierzulande ist häusliche Gewalt nicht erst seit der Corona-Pandemie ein Problem. Die Zahl der Übergriffe ist während des Lockdowns vielerorts deutlich angestiegen.
Eine erste Studie der TU München verdeutlicht die prekäre Situation der Frauen zum Zeitpunkt der striktesten Kontaktbeschränkungen: Für die repräsentative Studie wurden deutschlandweit 3.800 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren befragt. Die Studie hat ergeben, dass 3,1 Prozent der Frauen körperliche Gewalt und 3,6 Prozent sexuelle Gewalt während des Lockdowns erlebt haben. Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts sind damit ca. 1,3 Millionen Frauen betroffen.
Diese Risikofaktoren sind laut Pantelmann nie alleiniger Auslöser für häusliche Gewalt und Femizide. Verantwortlich sei vor allem „das Patriarchat”, genauer gesagt asymmetrische Machtverhältnisse und Abhängigkeiten: „Wenn jede Frau zu jeder Zeit einfach immer gehen könnte, dann würde das deutlich seltener passieren”, sagt Pantelmann.
Hilfsmaßnahmen kommen oft zu spät oder sind nicht bekannt
Doch wie wird mit der Problematik auf globaler Ebene und in Deutschland umgegangen? Und welche Maßnahmen würden sich Expert*innen wünschen?
Aranxa Pizarro Quiñones berichtet über die Lage in Peru. Die peruanischen Regierungsstrategien, um Gewalt gegenüber Frauen vorzubeugen, bestünden lediglich aus dem Angebot einiger weniger Not- und Anrufstationen, Ausschilderungen und Hotlines.
Doch nicht alle Frauen könnten in einer Notsituation zum Telefon greifen und Hilfe rufen, da teilweise die Ressourcen fehlten. Auch Sheela Saravanan erklärt, dass Frauen in Indien oftmals kein eigenes Handy besitzen. Ebenfalls hätten vor der Pandemie viele Frauen bei ihren Nachbar*innen, der Familie ihres Mannes oder den eigenen Familienangehörigen Schutz gesucht. Nur wenige meldeten sich bei einem Übergriff bei der indischen Polizei – weil Misstrauen bestünde. Durch die Corona-Pandemie bliebe vielen nun aber nichts anderes übrig.
Auch in Deutschland helfen bestehende Hilfsangebote betroffenen Frauen oft nicht weiter, wie die Münchner Studie ergab. Denn diese sind über die Angebote schlechter informiert als Frauen, denen keine Gewalt widerfahren ist. Das traurige Ergebnis: Nur 3,9 Prozent der Betroffenen haben bei der Telefonseelsorge angerufen, beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen” waren es sogar nur 2,7 Prozent.
Es erscheint naheliegend, dass betroffene Frauen bei Anwesenheit des*der Täter*in nicht zum Hörer greifen. Für diese Theorie sprechen auch die Zahlen der Berliner Justiz, die für den Monat März zunächst einen starken Rückgang in den Verfahren gemäß dem Gewaltschutzgesetz verzeichnet. Diese sind erst im April, nach den ersten Lockerungen, wieder angestiegen.
Genau aus diesem Grund wurde die Aktion „Codeword Maske 19“ ins Leben gerufen. Das Codeword soll betroffenen Frauen die Möglichkeit geben, unbemerkt beim Gang zur Apotheke auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Allerdings kannten nur 5,5 Prozent der betroffenen Frauen die Aktion. Wiederum hat ein Drittel der Frauen, denen das Angebot bekannt war, dieses auch genutzt.
Gesamtgesellschaftliche Debatte nötig
Auch in Frankreich wurden während der Ausgangsbeschränkungen in Apotheken und Supermärkten Stellen eingerichtet, bei denen sich Betroffene melden können. Pantelmann hält diese Hilfsangebote für sinnvoll, hätte sich aber frühere Maßnahmen gewünscht: „Als die Krise ausbrach und die Pandemie auch hier zu spüren war, war es im Prinzip schon zu spät.” Die Supermärkte als Anlaufstelle seien eine gute Idee gewesen, aber zu kurzfristig gedacht. So gäbe es beispielsweise Strukturen wie Frauenhäuser, die ausgebaut werden könnten, aber unterfinanziert seien. Notwendig sei eine gesellschaftliche Debatte, wie wir Gewalt gegen Frauen, Trans Menschen und auch gegen Kinder überhaupt zulassen können und was zu tun ist, um in dieser Hinsicht Veränderung zu erreichen: „Jetzt sagen, wir gründen ein Netzwerk oder eine NGO und dann ist alles schick, so einfach ist das nicht. Das wird ein langer, schwieriger Prozess sein, damit sich etwas ändert.”
Die Autor*innen der TU München-Studie geben konkrete Handlungsempfehlungen: Es solle Hilfsangebote per Chat und E-Mail geben und es brauche deutlich mehr Werbung für die bestehenden Angebote in öffentlichen Räumen. Auch die vier Redner*innen aus dem Panel sind sich einig, dass das geringe Ausmaß der medialen Berichterstattung einen wichtigen Teil zur Unwissenheit der Bevölkerung beiträgt. Somit fehlen nicht nur Informationen, sondern es wird auch verhindert, dass Betroffene, die ihren Fall öffentlich kommunizieren möchten, auf breite Akzeptanz in der Gesellschaft treffen.
Du bist selbst von häuslicher Gewalt betroffen und weißt nicht, an wen du dich wenden sollst? An der FU kannst du dich dafür diskret per E-Mail an die folgende Adresse wenden: no-means-no@fu-berlin. Dort wird dein Anliegen vertraulich bearbeitet, du erhältst eine Beratung und auf Wunsch auch eine Vermittlung an weitere Stellen. Weitere FU-interne und auch externe Angebote findest du zudem hier.